ERSTE ABTEILUNG. Reiseskizzen.
14. Kumanowa 99
15. Skopia 103
16. Katschanik 112
18. Prischtina 123
20. Janjewo 135
21. Gilan 141
22. Ueber das Niveau von Nord- und Süd-Dardanien 151
(Uebersicht der Niveauverhältnisse des Rinnsals der bulgarischen und vereinten Morawa) 155
23. Justinian's Geburtsort 155
24. Kaplan-Chan 159
25. Welesa 166
26. Babuna-Pass 172
27. Prilip 175
28. Bitolia 183
XIV. Kumanowa.
Der Polizeimeister von Kumanowa war uns mit drei Reitern bis Topanofze entgegen gekommen, und diese wohlberittene, in Roth und Gold gekleidete Eskorte verdunkelte durch ihre Phantasien unsere Wranjaner Begleitung der Art, dass sie sich sogleich in den Nachtrab zurückzog. Der Polizeimeister selbst, ein geborner Toske, hatte den Krimfeldzug mitgemacht, und war uns ein neuer Beleg für die auf der ganzen Reise bestätigte Beobachtung, dass der Dienst im grossherrlichen Heere eine wahre Bildungsschule für das türkische Element sei. Alle mit der Krim-Medaille Decorirten, welchen wir begegneten, waren stolz auf diese Auszeichnung, und machten sich sogleich durch Haltung und Benehmen kenntlich; sie schienen sich als uns näher stehend zu betrachten, und zeigten sich daher stets aufmerksam und dienstbeflissen. Nach diesen Erfahrungen müssten wir es für eine sehr zweckmässige Massregel ansehen, wenn die Pforte allen ihren verabschiedeten Soldaten eine einfache Bronzemedaille gewähren würde. Eine solche Auszeichnung müsste dieses mit der neuen Ordnung befreundete Element in der öffentlichen Meinung heben und es dadurch noch fester an die Regierung heranziehen. Ist doch der Culturmensch für solche äussere Zeichen empfänglich, um wie viel stärker muss also deren Wirkung auf den Naturmenschen sein.
Als wir uns der Stadt näherten, sahen wir den Weg und eine an ihm liegende Anhöhe mit Menschen gefüllt, und da es gerade Sonntag war, so vermutheten wir, dass sie sich zu irgend einem Feste versammelt hätten, fanden aber, dass sie uns entgegen gegangen waren. Sie drängten sich um den Wagen und überschütteten uns mit Segenswünschen. Es war, als ob wir den Leuten die Befreiung von einem grossen Uebel gebracht hätten. Am Kutschenschlage hielt sich ein alter Mann, und als ich diesem erzählte, dass ich vom Kloster St, Otatz käme, traten ihm die Thränen in die Augen, und er rief:
![]()
100
„Hört! er kommt vom Kloster!“ Vor der Stadt empfing uns die Geistlichkeit, wir stiegen ans, um sie zu begrüssen, und nun drängte sich Alles an uns heran, um mir die Hand zu geben und Major Zach nach griechischer Sitte zu umarmen, und dann ging es langsam durch das zunehmende Gedränge zum stattlichen Hause des Protosynkelos bei der neuen Kirche, in dem wir abstiegen.
Dieser Empfang erfüllte uns nach der ersten Ueberraschung mit Besorgniss, wir machten uns auf grosse Klagen und Bitten um Vermittlung gefasst, erfuhren aber zu unserer Beruhigung, dass die Leute gar nicht zu klagen hatten, sondern mit ihrer Lage ganz zufrieden waren, und dass sich der herzliche Empfang einfach aus der Freude über den Besuch fremder Christen und dem Umstande erklärte, dass der Festtag, auf den er fiel, der allgemeinen Neugierde die nöthige Musse gewährte, um uns zu sehen.
Kumanowa liegt an der Mündung der aus dem Karadag kommenden Lipkowka Rjeka in die Welika, welche hart am Nordende der Stadt zusammenfliessen. Die Stadt hat 650 Häuser, von welchen 300 muhammedanische und 350 christlich-bulgarische sind und ausserdem noch 30 Zigeunerhütten, was eine Bevölkerung von etwa 3500 Seelen ergeben dürfte. Sie soll noch vor 30 Jahren ein kleines Dorf von 20 christlichen und eben so vielen türkischen Häusern gewesen sein, und ist noch immer in rascher Zunahme begriffen, welche man jährlich auf wenigstens 20 Häuser anschlägt.
Der Hauptort des Bezirkes war früher Shegligowo, welches eine Stunde östlich von Kumanowa auf dem Wege nach Egri Palanka liegt. Diese Stadt hatte früher neun Kirchen, wovon jetzt noch eine erhalten ist, wurde aber bereits vor unvordenklicher Zeit, wie die Kumanowaner sagen, wegen seiner unerträglich heissen Lage verlassen. Kumanowa gilt dagegen, wenn auch nicht für absolut ges- und, so doch für gesünder und kühler, als alle Nachbarorte, und daher pflegt auch der Erzbischof von Skopia einen Theil des Sommers hier zuzubringen.
Der ausgedehnte Bazar zeigt auf regsame Handels- und Gewerbsthätigkeit, ihren Hauptstapel bildet die Wolle, welche auf den Weiden der Mustapha Owassi gezogen wird. Die Fleischer von Sophia und Adrianopel kommen bis Kumanowa, um Schafe zu kaufen. Die Stadt hat eine stattliche Thurmuhr, zwei mit Minarets geschmückte Moscheen und eine im Bau begriffene grosse Kirche, deren wir bereits gedachten. Rechts von ihrem Haupteingange fanden wir auf einem grossen viereckigen Piedestal die erste römische Inschrift, und wir gestehen, dass uns ihr Anblick freudig anregte, denn er zeigte ja,
![]()
101
dass der Boden, auf dem wir standen, eine Geschichte habe, dass wir wieder in die Länder eingetreten waren, wo die Steine reden. Eine Gegend ohne Vorzeit verliert viel von ihrem Beize, sobald wir uns dieses Mangels erinnern, mag uns ihr Anblick noch so freundlich anlachen, er stimmt uns wehmüthig, wie das Lächeln eines Taubstummen.
Der Bezirk von Kumanowa zählt 134 Dörfer, von welchen 90 christlich-bulgarisch sind. Man berechnet die Zahl der mohammedanischen Häuser des Bezirkes auf 1000, wovon jedoch kaum hundert von türkisch redenden Osmanen bewohnt werden. Die letzteren vertheilen sich auf die Dörfer Orla, Tschausehköi (bulgarisch Kletsofze) und Konjari siper (Bektasehli) und die Stadt, in der jedoch auch Muhammedaner bulgarischer Abstammung wohnen.
Der Weg von Kumanowa nach Skopia führt auf einer ebenen, doch gegen Westen zu stark, wenn auch unmerklich ansteigenden Terrasse, welche längs des südlichen Fusses des Karadag hinläuft und den nördlichen Band jener grossen welligen Hochebene bildet, die südlich bis Istib und Kumanowa, östlich bis Karatowa reicht und westlich an die Kettenebene von Skopia stösst, mithin sich über etwa dreissig geographische Quadratmeilen erstrecken mag. Sie soll grösstentheils aus magerem oder gänzlich unfruchtbarem Kieselboden bestehen. Ihr Nordrand, über welchen wir fuhren, machte keine Ausnahme von der Begeh Kiepert begreift diese Ebene unter dem Namen Mustapha Owassi. Als wir uns aber bei unseren Begleitern nach dieser erkundigten, behaupteten sic, dass die Mustapha Owassi bei Istib, also jenseits der unseren Horizont im Süden begrenzenden Berge liege. Diese Bergkette, welche wir schon vom Bujan erblickt hatten, war überhaupt ein unerwarteter Anblick, weil wir sie nirgends angegeben fanden. Sie schien von Osten nach Westen zu streichen und von dem Karadag fünf bis sechs Stunden entfernt zu sein; sie mag in ihrem Gipfel die Ebene vielleicht um 1500 Fuss überragen, fällt jedoch gegen den Wardar zu allmählich ab. Man bezeichnete sie uns als die Berge von Diwle mit dem Zusatze, dass sie die schönen weissen Steine liefere, aus welchen unter andern die grossen antik geformten Wasserkufen verfertigt würden, deren sich die Färber und Gerber von Skopia und anderen Nachbarstädten bedienten. Auch die Quadern der Brücke von Skopia und mehrerer Moscheen sollen aus den Steinbrüchen der Diwleberge stammen. Das Material schien uns ein weisser, leicht zu bearbeitender Sandstein zu sein. Es erinnert an das der in der ganzen Levante so verbreiteten Malteservasen und Malteserquadern, doch kam es uns compacter vor.
![]()
102
Diese Bergkette scheint wenigstens die grössere Osthälfte der Hochebene in zwei Theile zu zerlegen, von welchen der südliche Mustapha Owassi heisst, der nördlichere aber wenigstens von unseren Begleitern nicht benannt werden konnte, denn den Namen Usundsckowa beschränkten sie ausdrücklich auf die nördlichste Terrasse derselben, auf welcher wir fuhren. Die oben aus Hammer angeführte Stelle lässt vermuthen, dass dieser Theil der Ebene, wenigstens in der Nachbarschaft von Karatowa, zu Murad’s Zeiten Ulu Owa genannt wurde.
Das Dreieck, welches zwischen der Usundschowaterrasse und der stumpfen Winkelspitze liegt, welche der anfangs nach Westen und dann nach Südwesten streichende Südabfall des Karadag bildet, wird von einer auffallender Weise gegen Norden, also gegen die Wurzel des Karadag geneigten kleinen Ebene gebildet, welche, nach den zahlreich längs des Fusses des Karadag zerstreuten Dörfern zu schliessen, fruchtbarer als ihre südliche Nachbarschaft sein muss.
Am Westende der Usundschowaterrasse angelangt, wurden wir durch eine grossartige Gebirgsaussicht überrascht. Ihren VorderGrund bildet die tief unter uns gelegene Wardarebene, zu welcher sich der Weg auf einem gegen Südwesten abfallenden Vrorstosse des Karadag herabsenkt. Von dieser Ebene gleitet der Blick allmählich über sechs parallel von Norden nach Süden streichende, aber einander überragende Bergketten, und erhebt sich allmählich zu einer den Horizont abschliessenden Hauptwand, welche unsere Begleiter Schar nannten, wir aber nicht für dieses Hauptgebirge halten konnten, denn diese Kette lag schwerlich mehr als acht Stunden westlich von unserem Standpunkte, während der Schar nach den Karten noch einmal so weit davon entfernt ist [1]. Den scharf gekanteten Kämmen dieser Gebirge und ihrer geringen Breite nach zu schliessen, bestehen dieselben aus steil aufsteigenden nackten Felswänden. Sie zeigen zwei, wie es uns schien, durch sämmtliche Vorketten gehende Spalten. In der von Westen nach Osten laufenden Spalte tliesst die Markwa Rjeka dem Wardar zu, in der nach Südosten laufenden aber nach Behauptung der Skopianer der Wardar selbst.
Am Fusse jenes Ausläufers, auf welchem der Weg in die Ebene herabführt, liegt das Dorf Charadschina. Bei ihm kreuzen sich die Wege von Istib und Kumanowa. Es besitzt daher einen grossen Chan. Auffallender war uns jedoch ein anderer Besitz desselben; das
1. Diese mächtige Gebirgskette ist übrigens noch eine terra incognita. S. hierüber des Verf. Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar, Abth. I, S. 89.
![]()
103
Dorf hat nämlich 25 bulgarische Häuser oder bebaute Joche Land, und ist gleichwohl seit unvordenklichen Zeiten an 18 Spahi’s vertheilt, so dass die Mehrzahl dieser letzteren nicht mehr als ein Haus zu zehnten hat. Wir erinnern uns keines zweiten Falles, in welchem das Zehentrecht dieser Classe auf ein solches Minimum reducirt wäre. Uebrigens geht aus den zahlreichen gross herrlichen Verboten gegen die Zerstücklung der Spahilik's hervor, wie sehr das Institut diesem Missbrauche ausgesetzt war.
XV. Skopia.
Wir möchten die Beckenebene des Wardar um Skopia lieber als ein besonderes Ganzes, denn als integrirendes Glied der sogenannten Mustapha Owassi betrachten, weil sie bedeutend tiefer zu liegen scheint als diese und der grösste Theil ihrer überaus fetten Sohle wagrechter alter Seeboden zu sein scheint, während die Oberfläche jenes unfruchtbaren Landstriches mehr oder weniger accidentirt ist. Diese Beckenebene lässt sich in zwei Hälften zerlegen, wovon die kleinere nördliche zwischen dem Westhange des Karadag und dem Osthange des Karschjak mitten inne liegt, und im Norden von den Vorbergen des Nordwestendes des Schar abgegrenzt wird. Dieser Theil des Beckens mag im Durchschnitte 1/2 Stunden breit und drei Stunden lang sein. In dasselbe tritt der Wardarfluss auf den zwischen Kalkandele und Skopia liegenden Engen von Nordwesten her ein. Er hält sich an dessen westlichem Rande, indem er längs des Fusses des Karschiak fliesst, und bald nach seinem Eintritte in die Ebene nimmt er den die Nord wand longirenden Lepenatz auf. Diese nördliche und westliche Neigung des Beckens wird durch einen niederen Felsrücken veranlasst, welcher, von Süden nach Norden streichend, den unteren Theil des Beckens in zwei Hälften theilt und sich in mehreren Aufstössen gegen Norden fortsetzt. An diese letzteren prallt der von Nordwesten kommende Wardar an, und erhält dadurch die Richtung von Norden nach Süden. Etwa in der Mitte des Beckens sattelt jener, Kamenik genannte Felsrücken zum ersten Male ein, und in dieser Einsattlung liegt die Stadt Skopia, auf dem ersten nördlichen Aufstosse aber ihre Citadelle, deren nördlicher und westlicher Abfall von dem Wardar bespült wird. In dieser Einsattlung fliesst ein vom Karadag kommender Bach dem Lepenatz parallel mitten durch die Stadt in den Wardar.
![]()
104
Das Südostviertel des Beckens zwischen Kamenik und Karadag senkt sich dagegen nach Süden und schickt sein Wasser den den Südwesten der grossen Wardarebene, d. h. der grösseren Südhälfte unseres Beckens einnehmenden Sümpfen zu, weil der Karadag einen niedern Bühl bis zu der ersten Einsattlung des Kamenik herabsenkt, und durch diesen die Osthälfte des Beckens von Skopia in zwei Theile zerlegt wird.
Das Becken von Skopia hängt gegen Süden unmittelbar mit der Wardarebene zusammen und lässt sich als ein Busen derselben betrachten. Diese Ebene mag drei Stunden breit und eben so lang sein. Im Osten wird sie nicht gleich jener durch den Karadag, sondern durch den etwas zurücktretenden Band der sogenannten Mustapha Owassi begrenzt. Anderntheils macht die südliche Fortsetzung des Karschiak eine grosse Ausbauchung gegen Westen, und hieraus erklärt sich die grössere Breite der Ebene im Vergleiche zu dem Busen von Skopia.
Wenn wir im Nebel richtig sahen, so behält in derselben der Wardar im Ganzen seine Richtung von Norden nach Süden bei, macht aber, bevor er die das Becken im Süden begrenzenden Hügel durchbricht, eine Wendung gegen Südosten. Vor seinem Eintritte in das Défilé nimmt er den Abfluss jenes Sumpfsees auf, welcher die Osthälfte der Ebene einnimmt und dessen Spiegel bei mittlerem Wasserstande etwa eine Stunde lang und eben so breit sein mag.
Dieser See macht das ganze Becken von Skopia zu einem Fieberneste, und doch wäre seine Austrocknung allem Anscheine nach sehr leicht, da man nur einen Canal durch die Einsattlung zu führen brauchte, welche zwischen der Südostecke des Sumpfes und der bedeutend niedrigeren Ptschinja liegt, und dieser Zwischenraum kaum eine halbe Stunde betragen dürfte.
Wir fuhren von Charadschina aus in der Richtung von Osten nach Westen quer durch die Ost hälfte der Ebene, welche nach allen Anzeichen von den Winterregen in einen Sumpf verwandelt wird, gelangten zu dem südlichen Abfall des vorerwähnten Felsrückens Kamenik, bogen, sobald es dieser verstattete, gegen Norden, und fuhren am Fusse seines westlichen Abfalles der Stadt zu, ohne des Wardar gewahr zu werden, der nicht weit von unserer Linken floss, sich aber hier bereits tief in die Ebene eingegraben hat. Eine halbe Stunde vor der Stadt begrüsste uns der Kaimakam, ein schöner, angehender Dreissiger, welchen der feine Schliff seiner Formen sogleich als Constantinopolitaner verrieth, der aber leider nur türkisch sprach. Er wies dem Verfasser einen schönen Hengst an, um darauf
![]()
105
in die Stadt zu reiten, eine Aufmerksamkeit, die derselbe erst dann zu würdigen vermochte, als Herr Gottschild, der im Wagen geblieben war, die kritische und unbequeme Lage schilderte, die er in den mit grossen Steinen gefüllten Sumpflöchern zu bestehen hatte, durch welche der Weg führt, und doch ging es nicht durch die Stadt, sondern im Bogen um ihr äusserstes Ende zu dem Wardarufer, weil das Innere derselben für Wägen noch inpracticabler war. Der Kaimakam führte uns zu dem Hause eines Wlachen, der von dem Pachte eines am Eingänge der Stadt gelegenen Chanes lebt und uns seine aus drei freundlichen und aüsserst rein gehaltenen Zimmern bestehende Hauptwohnung einräumte, indem er sich mit seiner Familie in einen Hinterbau zurückzog. Dieser Mann sprach nicht nur das Neugriechische wie seine Muttersprache, sondern auch albanesisch, bulgarisch und türkisch mit Geläufigkeit, und wunderte sich, als wir ihm darüber unser Erstaunen ausdrückten, da wir doch wohl wissen müssten, dass es so leicht keinen Handel und Gewerbe treibenden Wlachen gebe, der nicht neben seiner Muttersprache griechisch, albanesisch und bulgarisch und in der Regel auch etwas türkisch verstehe. Der Manu besass auch die den Wlachen eigene Gewecktheit und rasche Auffassung; er begriff schnell, was wir in diesen Ländern suchten, und lieferte uns nicht nur die nöthigen Nachweise über die ihm selbst bekannte Umgegend der Stadt, sondern brachte auch Leute, welche Auskunft über andere uns interessante Striche geben konnten, und unterstützte uns beim Ausfragen derselben in sehr verständiger Weise. Er hiess Janni, und setzte bei der Unterschrift noch den Taufnamen seines Vaters Athanasius hinzu, denn die meisten Bewohner der Südhalbinsel haben bekanntlich noch keine Familiennamen im europäischen Sinne, und ersetzen dieselben, gleich den alten Hellenen, durch den ihres Vaters.
Die ersten Erkundigungen, welche wir in Skopia einzogen, waren jedoch nicht topographischer Natur, sondern galten dem alten Skopia, der gewesenen Hauptstadt von Dardanien, welche eine Zeit lang auch den Namen Justinianea prima führte, den ihr Kaiser Justinian gegeben hatte. Der neue Name konnte jedoch bei dem Volke keine Wurzel fassen und gerieth daher bald in Vergessenheit, während der ursprüngliche Name Skopia sich bis auf unsere Tage erhalten hat. Wir glauben nämlich nach Männert’s Vorgänge [1],
1. Geographie der Griechen und Römer. VII, 107. S. über diese Streitfrage auch des Verf. Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar, Abth. I, 8. 132 u. f.
![]()
106
dass beide Namen eine und dieselbe Stadt bezeichnen, und berufen uns zur Unterstützung dieser Ansicht vor allem auf die von der Natur selbst, wie bei wenigen, vorgezeichnete Lage dieser Stadt, denn inmitten einer ausgedehnten, äusserst fruchtbaren Ebene, in welche zwei in unumgehbaren Engpässen laufende Hauptstrassen der Halbinsel münden, von denen die nördliche nach dem Amselfelde und seinen nördlichen Hinterländern, die westliche aber nach Albanien und bis zur adriatischen Küste führt, erhebt sich ein gegen Norden und Westen vom Wardar bespülter und schroff gegen den Fluss abstürzender, von allen Seiten freier Felshügel. Schon der erste Einwanderer konnte daher über die Wahl des Ortes nicht zweifelhaft sein, wo er sich anbauen sollte, und seine Nachfolger keine neue Stelle wählen, wenn die frühere Ansiedlung verwüstet wurde, oder sonst verödete. Hier also lag die alte Hauptstadt des Landes, wie die Fortdauer ihres Namens an derselben Stelle beweist, und hier musste sie Justinian wieder aufbauen, wenn sie zu seiner Zeit verödet war. Zwar nennt Prokop ihren alten Namen nicht, und richtet der Schmeichler seine Darstellung so zu, dass der Kaiser als Gründer der ganz neuen Stadt Justinianea prima erscheint, aber wir fragen mit Mannert, wie erklärte es sich dann, dass in seinem langen Verzeichnisse dardanischer Städte und Dörfer, die Justinian wieder hergestellt haben soll, gerade die alte Hauptstadt Skopia fehlt? Wie hätte die neue Stadt so schnell die grosse Volksmenge erhalten können, von der Prokop spricht, da er von einer Ueberpflanzung aus anderen Städten in die neue nichts berichtet, was er, wenn sie stattgefunden, gewiss nicht unterlassen hätte?
Zwar findet es sich später, dass die Metropoliten von Ochrida als Erzbischöfe von Justinianea prima und von Achridae unterzeichnen, aber gerade dieser letzte Name beweist, dass das alte Lychnidus und das heutige Ochrida eine von Justinianea prima verschiedene Stadt gewesen sein müsse, und dass die Erzbischöfe von Skopia diesen ihren bisherigen Titel nach Ochrida mit hinüber nahmen, als die bulgarischen Könige dieses zur Hauptstadt ihres Reiches wählten und den Sitz des Erzbisthums von Skopia in dieselbe verlegten. Ferner war Lychnidus wegen seines Quellenreichthums innerhalb seiner Mauern bekannt [1] ; wozu bedurfte es dann der Wasserleitung, mit welcher Justinian seine neue Schöpfung nach Prokop beschenkte? Eine solche findet sich aber, wie wir weiter unten sehen werden, in Skopia. Endlich aber glauben wir in den
1. Malchus in ex. de legat. pag. 64.
![]()
107
Namen der in seiner Umgegend gelegenen Dörfer Taor und Bader Verstümmlungen der von Prokop angeführten Heimathsorte Justinian's, Tauresium und Bederiana, zu erkennen.
Da dieser Schriftsteller die einzige Quelle für die angeführten Daten ist und wir auch später auf dieselben zurückkommen müssen, so möge hier ein Auszug aus der betreifenden Stelle Platz finden [1].
„Bei den europäischen Dardanen, welche hinter den Grenzen der Epidamner sitzen, war in der Nähe des Castells, welches Bederiana heisst, ein Dorf mit Namen Tauresium, aus welchem der Kaiser Justinian stammt. Um dieses Dorf zog er eine Mauer in Form eines Vierecks, führte in jedem Winkel einen Thurm auf und bewirkte dadurch, dass es ein Tetrapyrgon (Vierthurm) war und auch so genannt wurde. In der Nähe dieses Dorfes aber baute er eine prächtige Stadt, die er Justinianea prima nannte, und zwar als Pflegelohn für die Landschaft, welche ihn aufgezogen hatte. Daselbst erbaute er auch eine Wasserleitung, und versorgte dadurch die Stadt auf das reichlichste mit fliessendem Wasser. Ausserdem führte er daselbst noch viele andere ungeheure und des Gründers würdige Werke aus. Denn es ist nicht leicht, die Gotteshäuser dieser Stadt aufzuzählen und die Ungeheuern Paläste der Archonten, die Grösse der Säulenhallen, die Schönheit der Märkte, die Brunnen, Strassen, Bäder und Kaufhäuser zu beschreiben. Kurz es ist eine grosse, volkreiche und mit Allem gesegnete Stadt, und würdig, die Hauptstadt des ganzen Landes zu sein. Ueberdem wies er sie dem Erzbischof von Illyrien als die grösste unter den Städten des Landes zum Sitze an.“
Von all' dieser Herrlichkeit der Justinianea ist, wenn sie jemals existirte, bis auf die Wasserleitung nichts mehr vorhanden. Diese leitet das Wasser des Baches, welcher aus der letzten nördlichsten in die Ebene mündenden Thalfalte des Karadag kommt, durch die Ebene in die Stadt und fasst dasselbe jedoch schon ein gutes Stück thalaufwärts, so dass man ihre Länge auf 2 1/2 Stunden schätzt. Eine Viertelstunde von dem nordöstlichen Stadtende war eine unumgehbare muldenartige Bodensenkung zu überwinden, sie wurde daher in römischer Weise durch eine Bogenreihe überbrückt, welche von weitem betrachtet, ein recht schlankes Ansehen [2] hat, aber bei nahem Besehen gerade kein Baumuster und selbst in ihren alten Theilen
1. Prokop de aedificiis. IV, 1.
2. Die in der Mitte liegenden höchsten Bogen ergaben 3 Meter 25 Cent. Pfeilhöhe, 2 Meter 40 Cent. Sprengung, 2 Meter 15 Cent. Dicke der Pfeiler.
![]()
108
nachlässig gearbeitet ist. Ihre Rundbogen, deren Anzahl etwa 120 betragen mag, bestehen aus zwei Reihen je lang und quer gelegter Backsteine, welche % Meter lang und vier bis fünf Centimeter dick sind. Ueber denselben läuft ein Band von flach neben einander gelegten Ziegelsteinen, zur Andeutung des Bodens des Wasserkastens, welcher achtzig Centimeter breit ist, und auf dessen Decke man über die ganze Pfeilerreihe hin gehen kann. Die in den Mauerflächen zwischen den Bogen eingesprengten kleinen Nebeubogen, welche sich so häufig an byzantinischen Brücken finden und vermuthlich die Entlastung der Bogen bezwecken, fehlen auch hier nicht, doch wechseln bei ihnen auffallender Weise Spitzbogen und Rundbogen in bunter Reihe. Das aus dem nächsten Bachbette aufgeraffte Steingeschiebe scheint das Hauptmaterial zu diesem Baue geliefert zu haben. Alles Suchen nach Inschriften oder eingemauerten alten Rudera war vergebens, das Wenige, was sich von letzteren vorfand, verdient keine Beachtung.
Mehrere nördlich von dieser Wasserleitung aus Quadersteinen erbaute kleine Brücken und gewölbte Durchlässe zeichnen sich gegen dieselbe durch die grosse Sorgfalt ihrer Construction aus, sie sind offenbar alt, doch wagen wir ihr Zeitalter nicht näher zu bestimmen.
Der erste Blick auf die Umfassungsmauern des Castells der Stadt zeigt, dass zu denselben eine Masse alter Quadersteine verwendet worden sei, doch fand sich bei näherer Untersuchung keiner, von dem sich mit Sicherheit behaupten Messe, dass er noch an seiner ursprünglichen Stelle liege, alle schienen bei einem späteren Umbaue den Platz gewechselt zu haben. In der Regel finden sich bei alten Festungsmauern trotz ihres Umbaues Spuren ihrer ältesten unverrückten Fundamente, und sind sie an ihrer vortrefflichen Fügung von den jüngeren darauf stehenden Aufsätzen leicht zu unterscheiden. Aber an der Akropolis von Skopia wollte uns, so weit deren Mauern aus der Schneedecke hervorragten, eine solche Unterscheidung nicht gelingen. Trotzdem zweifeln wir nicht, dass die neue Citadelle den Raum der alten einnimmt, weil dieser von der Natur zu scharf vorgezeichnet ist. Auf unsere Frage nach Inschriften zeigte uns der Festungscommandant eine rohe Inscription aus schuhlangen, aber halbverwischten slavischen Lettern über dem Haupteingangsthore. Wir konnten dieselbe von unten aus nicht entziffern, und eine Leiter, welche bis zu ihnen reichte, war nicht aufzutreiben. Aus demselben Grunde konnten wir auch eine links von diesem Hauptthore in die äussere Festungsmauer umgekehrt eingemauerte dunkle Steintafel mit einer aus acht bis neun Zeilen bestehenden Inschrift in schönen
![]()
109
römischen Lettern, vermuthlich ein Grabstein, nicht copiren. Zu derselben führt ein schmaler Gang zwischen der Mauer und einem in dem Vorraume der Festung stehenden Magazine. Die Festung hat nämlich gegen die Stadt zu doppelte Mauern und ist noch ausserdem durch einen gemauerten Graben geschützt, über welchen eine Zugbrücke führt. Das Réduit der Festung liegt in dem Nordostwinkel; es blieb uns jedoch verschlossen, weil es von dem Harem eines Oberofficiers bewohnt wird.
Die crenelirten Mauern der Festung und die Bauten im Innern derselben waren übrigens gleich dem dort aufgestellten Materiale im besten Stand und bildeten zu dem verwahrlosten Aussehen der Stadt einen glänzenden Abstich. Trotz ihrer vielen Moscheen, von welchen sich einige durch die grosse Schönheit ihrer Formen auszeichnen, macht diese letztere nämlich den Eindruck des Rückganges und Verfalles, wozu allerdings auch die mit zahllosen Grabsteinen und verfallenen grösseren Gräberbauten bedeckten Ungeheuern Kirchhöfe beitragen mögen, welche sich an den die Stadt umgebenden Höhen aufwärts ziehen und deren Anblick durch keinen einzigen Baum gemildert wird, während doch ein im Innern der Stadt gelegener Kirchhof einen prächtigen Bestand von alten Cypressen hat.
Die über den Wardar zu dem auf dessen rechten Ufer gelegenen Viertel führende Steinbrücke dürfte, ihrem Style nach zu schliessen, das Werk eines italienischen Baumeisters der zwei letzten Jahrhunderte sein; denn von Allen, die wir hierüber fragten, wusste Niemand eine Antwort zu ertheilen ; wir konnten überhaupt keinerlei sichere Auskunft über die Stadtgeschichte erhalten, obwohl wir es an Fragen nicht fehlen liessen. Ohne einen glücklichen Zufall bedarf es zur Auffindung von Individuen, welche solche Auskünfte zu ertheilen vermögen, eines längeren Aufenthaltes an Ort und Stelle. Die zur Brücke führende Strasse läuft durch den Bazar, welcher weit ärmlicher bestellt war, als wir vermuthet hatten, und bildet die Hauptarterie des Verkehrs. Längs des Wardar, dessen ungemein rasche Strömung uns auffiel, zieht sich das Viertel der christlichen Archonten mit der Wohnung des Erzbischofs, eines freundlichen, gesprächigen Prälaten, und der neuerbauten Stadtkirche. Die Archonten sollen meistens wlachischer Abstammung sein, und die stattlichen Häuser und der Luxus, mit welchem sie ausgestattet sind, zeugen nicht nur von dem Reichthum ihrer Bewohner, sondern auch von der Sicherheit, in der sie sich fühlen, denn unter den früheren erblichen Pascha's dürfte es schwerlich ein christlicher Bewohner von Skopia für gerathen gehalten haben, seinen Reichthum in der
![]()
110
Art durch äussere Belege zu documentiren, wie dies jetzt geschieht. Die Häuser, welche wir betraten, zeichneten sich durch eine wahrhaft holländische Reinlichkeit aus.
Von den Bauten der Stadt dürfte ausser den Moscheen nur noch der sogenannte Blei-Chan (Kurschumli-Chan) Beachtung verdienen. Die Gebäude, welche diesen Namen führen, sind bekanntlich feuerfeste, gegen aussen wohlverwahrte Kaufhäuser und Quartiere für fremde Handelsleute. Der von Skopia bildet ein massiv gebautes zweistöckiges Viereck, welches nur im zweiten Stocke stark vergitterte Fenster gegen aussen hat. Man gelangt durch ein mächtiges, eisenbeschlagenes Festungsthor in den mit Quaderplatten belegten Hof, in dessen Mitte ein Springbrunnen steht: ringsum laufen gewölbte Gänge, zu welchen zwei steinerne Stiegen führen. Im unteren Stocke befinden sich die Magazine, welche nur von der Hofseite Licht und Luft empfangen, im oberen die aus zwei Abtheilungen bestehenden Gemächer, deren jedes von einer kleinen in Blei gedeckten Kuppel (daher der Name des Baues) überwölbt ist. Das Ganze ist in einem einfachen, kräftigen und doch harmonischen Style gehalten, und würde daher ohne die Verwahrlosung, unter der der Bau seinem gänzlichen Ruine entgegengeht, jedem Beschauer gefallen. Einen eigenthümlichen Eindruck machen die mit schwarzer oder rother Farbe auf den Pfeilern eingeschriebenen Namen der Ragusaner [1]) und Venetianer Kaufleute, welche noch im vorigen Jahrhunderte Skopia besuchten. Diese fremden Kaufleute sind verschwunden und an ihre Stelle sind Händler aus der Umgegend und Miethsleute aus der Stadt getreten, und die unteren Räume sind an einheimische Kaufleute vermiethet. Das Gebäude ist Wakuf, d. h. es gehört einer frommen türkischen Stiftung, deren Verwalter nur auf die Erhebung der Miethen bedacht sind, ohne das Geringste für die Erhaltung des Gebäudes zu thun.
Aus unserer Beschreibung ergibt sich, dass der armen Stadt das Prädicat der „Braut Griechenlands“ nicht mehr zukommt, wie sie nach Hadschi Khalfa’s [2] Zeugniss „in den altgriechischen Büchern“ genannt wurde. Sie war wohl auch zu seiner Zeit noch blühender als jetzt, denn er erzählt von ihr, dass sie mehrere Moscheen, ein Besestan, schöne Spaziergänge, ein festes Schloss und eine Thurmuhr [3] besitze, welche noch aus den Zeiten der Ungläubigen
1. Auch E. Brown im Jahre 1609 übernachtete in Prokop in dem Hause eines dort angesessenen Ragusaner Kaufmanns, s. dessen Reise, deutsche Uebersetzung. Nürnberg 1686, S. 125.
2. Rumeli und Bosna S. 95.
3. Auch Brown S. 128 gedenkt derselben. Er schildert Skopia als die handelsreichste und grösste Stadt des Landes mit 700 Lederern und Rothgärbern. Er sah dort viele schöne Häuser, und die besten hatten kostbare Teppiche und vergoldetes und bunt gemaltes Schnitzwerk in den Zimmern, ferner eine grosse Anzahl Moscheen, deren (auch jetzt noch) schönste auf einem Berge (vermuthlich in der Nähe der Festung) steht und eine breite auf vier Marmorsäulen ruhende Kuppelgalerie vor sich hat; dann ein Gewölbe, das sehr alt zu sein schien, und in dem ein Bach floss ; weiter einen grossen Stein, welcher ein Säulenstück zu sein schien mit der Inschrift SHIANG; endlich ausserhalb der Stadt die grosse Wasserleitung mit 200 (!) gewölbten Bogen.
![]()
111
stamme und die grösste der in der Christenheit berühmten Thurmuhren sei. Sie schlage Tag und Nacht die Stunden, und ihr Schall werde drei Stunden von der Stadt gehört, auch habe ein besonderer Uhrmacher die Aufsicht über sie. Leider kannten wir Khalfa’s Notiz bei unserem Besuche noch nicht, sonst würden wir uns nach dieser Uhr besonders erkundigt haben. Der Stadtuhrthurm von Skopia schien uns von seinen Brüdern nicht verschieden, welche man fast in allen türkischen Städten, und hie und da selbst in grösseren Dörfern antrifft. Sie sind viereckig, ihre untere Hälfte ist meist aus Stein gebaut, die obere der Resonnanz wegen mit Brettern verschlagen. Die Glocke hat gewöhnlich die Form der Glocken unserer Pendeluhren, und ist in einem auf der Spitze des Thurmes stehenden kleinen Holzkiosk angebracht.
Die heutige Bevölkerung der Stadt wird auf 13,000 Muhammedaner, 7000 griechische Christen und 800 Juden angegeben.
Die serbische Sage betrachtet Skopia als den Sitz des Marko Kral. Es heisst von ihm, dass er sich den Türken unterworfen und in deren Feldzügen in Asien grossen Ruhm erworben, aber an der Schlacht auf dem Amselfelde keinen Theil genommen habe, und endlich von den Türken aus dem Wege geräumt worden sei. Diese Züge deuten so bestimmt auf eine historische Persönlichkeit hin, dass es auffallen muss, dass die türkischen Quellen von derselben schweigen, denn bei Hammer kommt der Name gar nicht vor, und von Skopia berichtet [1] er nur, dass es Bajesid noch im Jahre seiner Thronbesteigung (1389), also unmittelbar nach der Schlacht auf dem Amselfelde, mit türkischen Colonien bevölkert habe, und diese Notiz lässt für Marko Kralewich nach der Schlacht keinen Raum in Skopia übrig.
An Ort und Stelle konnten wir von Marko Kralewich nur zwei Züge erfahren, und diese gehören dem alten Gott an. Unser Hausherr kannte nämlich unweit der Stadt einen in der Ebene
1. I, S. 188,
![]()
112
liegenden, mit einem Kreuze bezeichneten Felsblock, welchen Marko von dem Karschiakberge über den Wardar geschleudert haben soll. Und am Ende des Défilé’s, ans dem der Lepenatz in die Ebene tritt, zeigte man uns hart rechts vom Wege eine mit Gesträuch bestandene niedere Stelle, welche das „Grab des Kiesen“ heisst, der hier im Zweikampfe gegen Marko Kralewich gefallen und begraben sei. Wir finden diesen also hier an seiner Lieblingsstelle, an einem Felsdéfilé, durch welches Wasser läuft.
XVI. Katschanik.
Von Skopia wandten wir uns in rückläufiger Bewegung gegen Norden, um das Amselfeld zu besuchen und den Versuch zu machen, von Südwesten aus in das albanesische Dardanien vorzudringen, und schlugen zu dem Ende den Weg nach Katschanik ein. Derselbe führt durch den nordöstlichen Theil der Ebene zu der Stelle, wo der Lepenatz, welchen man auch die Lepenitza nennen hört, ans seinem Défilé tritt und längs des nördlichen Randes der Ebene dem Wardar zuläuft.
Man hatte uns in Skopia gesagt, dass die Fahrstrasse durch das Défilé frisch gemacht worden sei, wir waren aber nicht darauf vorbereitet, eine Kunststrasse vorzufinden, welche verständig nivellirt und gut gebaut war; es wäre daher sehr zu wünschen, dass auch auf ihre Erhaltung die nöthige Sorgfalt verwendet würde, welche namentlich an zwei Stellen zur Verhütung grosser Unglücksfälle unumgänglich ist. An diesen läuft nämlich die Strasse auf leichten, an senkrechte Felswände angelehnten Holzbrücken [1] über wenigstens 100 Fuss tiefe Precipisse, denn ihre Einsprengung hätte zu viel Kosten verursacht. Diese ganze, wenigstens vier Stunden lauge Strasse hat nämlich nach der einstimmigen Versicherung des Kaimakams von Skopia, welcher den Bau leitete, und des Ingenieurs, welchen wir in Bitolia sprachen, dem Aerare nicht mehr als 90,000 Piaster, also etwa 8000 Gulden für die unumgänglichsten Kunstbauten und Sprengungen gekostet.
1. Diese Behelfe waren schon den Römern bekannt, denn die durch die Flussenge des eisernen Thores der Donau gebaute Strasse lief grösstentheils auf solchen Brücken. An den in den Felswänden angebrachten Einlässen für die Stützbalken lässt sich der Lauf jener Römerstrasse noch heut zu Tage verfolgen. Gegenwärtig läuft längs des österreichischen Ufers eine in die Felsen eingesprengte Chaussée.
![]()
113
Alle Handarbeit wurde von den aufgebotenen Dörfern der Nachbarschaft geleistet, und da diese meistens von muhammedanischen Albanesen bewohnt werden, welche keinen Zwang vertragen, so erforderte es grossen Tact von Seiten des Kaimakams, die Leute bei gutem Muthe zu erhalten und Conflicte mit dem an soldatischen Gehorsam gewohnten Ingenieur zu vermeiden. Wer die Störrigkeit und Unbändigkeit der Albanesen kennt, muss billig über das Stück Arbeit staunen, das sie hier geliefert haben, und wird an ihrer endlichen Fügsamkeit in zahmere und geordnetere Verhältnisse nicht gänzlich verzweifeln. Der südliche Theil des Défilé’s, welcher von Südosten nach Nordwesten streicht, ist offener als der nördliche, streng von Süden nach Norden laufende. Beide Abschnitte werden durch die Mündung der von Westen dem Lepenatz zufliessenden Pustenika Rjeka bezeichnet, und hier erhebt sicli die stets längs des linken Ufers des Lepenatz laufende Strasse wegen des steilen Absturzes der Thalwand bis zu 250 Fuss über dessen Spiegel.
Die Südhälfte des Défilé’s ist, wo die Felsen nicht nackt liegen, mit kümmerlichem Eichengestrüppe bewachsen. An den steilen Hängen der engen nördlichen Hälfte dagegen steht Buchenholz und streckenweise sehr schöne Bäume, der einzige Buchhochwald, den wir auf der ganzen Reise sahen, und auch dieser reichte nicht an unsere nordischen. Die südliche Waldnatur hat überhaupt für das nordische Auge stets einen ungesunden, verkümmerten oder verkrüppelten Charakter. Die Hauptschuld tragen die Ziegen, welche die Waldgegenden bis zu den höchsten Bergspitzen beweiden und durch das fortfahrende Abfressen der Herzkeime die Laubholzpflanzen zu Strauchkrüppeln machen, und wenn auch hie und da eine sich in die Höhe schwingt, so gelingt es ihr nicht unversehrt, und die Hirten besteigen selbst die grossen Bäume, um mit ihren Handschars von ihnen die Zweige abzuschlagen, welche die Ziegen nicht erreichen können. Was die Ziege übrig lässt, zerstört dann periodisch das Feuer, welches der Hirte im Hochsommer anzulegen pflegt, um mit seiner Asche den Boden zu düngen, und fetteren Graswuchs unter den schwarzen Reisern zu erzielen. Kurz, der südliche Wald ist ein trauriger Anblick für den Waldfre- und, und dennoch würde er Unrecht haben, wenn er hier Schonung für die Holzung verlangen wollte, denn die Ziegen bilden im Nationaleinkommen einen Hauptposten, während das Holz keinen Werth hat und die schönsten Stämme meist an den Stellen, wo sie gewachsen, nutzlos verfaulen.
In dem Défilé liegt kein Dorf, doch nannte man uns verschiedene in den Seitenthälern gelegene als durchweg von Albanesen
![]()
114
bewohnt, mit dem Zusatze, dass es arme Leute seien. Es hätte dieses Zusatzes nicht bedurft, denn ihre Heimat heisst ja Karadag, der schwarze Berg. Der Türke bezeichnet mit diesem Appellativ jedes zerrissene, felsige und daher unfruchtbare Bergland. So heisst z. B. Montenegro nicht nur auf italienisch, sondern auch in allen Sprachen, welche auf der Halbinsel gesprochen werden, der oder die schwärzen Berge, obgleich sie nur aus grauweissen Kalkfelsen bestehen, und zeigen alle diese Sprachen, aber keine mehr als die albanesische, die Neigung, die Eigenschaften glücklich und gut durch die weisse, und unglücklich und böse durch die schwarze Farbe zu bezeichnen.
Die engste Stelle des Défilé’s ist kurz vor seinem nördlichen Anfänge, eine kleine halbe Stunde südlich von Katschanik. Sie wird durch eine unmittelbar aus dem Flusse, etwa 250 Fuss senkrecht aufsteigende Felswand gebildet, welche sich in der Richtung von Westen nach Osten die östliche Böschung der Thalenge hinaufzieht, während die westliche Böschung gleichfalls sehr steil in den Fluss abfällt. Durch diese Felswand führt ein künstlicher Tunnel, welcher 22 Schritte lang, 12 Fuss breit und zwischen 10 und 12 Fuss hoch ist. Links vom südlichen Ende ist eine kleine Steintafel mit einer türkischen Inschrift in der Felswand angebracht, welche die Jahreszahl 1172 (1794) trägt und einen Pascha von Skopia als den Urheber dieses Werkes nennen soll. Die etwas stromabwärts von dem Tunnel sichtbaren Ruinen einer Brücke zeigen, dass vor diesem Durchbruche der Weg, jene Felswand umgehend, auf dem rechten Flussufer führte.
Kurz vor seinem Eintritte in das Défilé nimmt der Lepenatz einen von Norden nach Süden laufenden Bach, die Neredimka Rjeka, auf, von dessen merkwürdiger Gabelung in seinem Quellgebiete später die Rede sein wird. In dem Mündungswinkel liegt ein altes Castell, dessen mit Zinnen versehene und von Thürmen flankirte, sehr ruinirte Umfassungsmauern ein Dreieck bilden. Ein an dessen Nordseite angebauter Thurm scheint das Reduit der Festung gebildet zu haben. Die Anlage dieser zur Beherrschung der Zugänge zu dem Défilé erbauten Befestigung fällt offenbar vor die Erfindung des Schiesspulvers, da sie von allen in ihrer nächsten Nachbarschaft gelegenen Höhen beherrscht wird. Dieser Festung gegenüber liegt längs des linken Ufers der Neredimka das freundliche Städtchen Katschanik auf einem schmalen Rande, hinter welchem eine etwa 60 Fuss hohe Terrasse als letzter Vorstoss des Karadag in dieser Richtung aufsteigt. Eine schöne Moschee und die Ruinen eines grossen Blei-Chan (Kurschumli-Chan) überragen die Häuser des Ortes,
![]()
115
deren Anzahl sich auf etwa siebzig belaufen mag, und deren Bewohner fast lauter muhammedanische Albanesen sein sollen.
Katschanik ist zur Raubburg wie geschaffen, weil der LepenatzPass nicht umgangen werden kann, sie wird auch als solche von alten serbischen Liedern öfters erwähnt, und blieb bis zum Anfänge dieses Jahrhunderts der Sitz von Wegelagerern; erst im Jahre 1807 gelang es Reschid Pascha von Kalkandele, die Gegend von ihnen zu säubern, nachdem er ihre Wälder verbrannt hatte. So erzählen Pouqueville und Boué [1].
Den wenigsten unserer Leser dürfte es jedoch bekannt sein, dass der Boden von Katschanik mit dem edelsten deutschen Blute getränkt sei. Die diese Katastrophe betreffenden Thatsachen wurden unseres Wissens zum ersten Male von A. Arneth in seinem Leben des Grafen Guido Starhemberg an’s Licht gezogen, und es möchte hier ein Auszug der hierüber handelnden Stellen dieses vortrefflichen Werkes um so mehr an seinem Platze sein, als dieselben auf die Albanesen dieser Gegenden einiges Licht werfen, wobei wir uns jedoch die geographischen Angaben nach unserer Anschauung näher zu bestimmen erlauben. Nach dem früher erwähnten glänzenden Siege der kaiserlichen Armeen bei Nisch und der Eroberung dieser Stadt wandte sich das Gros der Armee nordwärts gegen Widdin und die Wallachei, Graf Piccolomini aber drang an der Spitze der in Serbien zurückgebliebenen Truppen rasch gegen Süden vor, besetzte Prischtina und das Amselfeld sammt dem Passe von Katschanik, ja er sendete seine Vorposten sogar durch denselben, und diese occupirten die jenseits gelegenen Ortschaften, und darunter sogar die alte Hauptstadt Dardaniens, Skopia. Die christlichen Bewohner dieser Gegenden, welche den tapfern und menschenfreundlichen Piccolomini als Erretter von dem Joche der Ungläubigen begrüssten, erklärten sich zur Rückkehr unter christlichen Scepter bereit, wenn sie gehörig unterstützt würden. Die Türken aber waren über die Erfolge der kaiserlichen Armee so niedergeschlagen, dass dies der günstigste Moment zum Frieden gewesen wäre; er wurde leider versäumt, und nun erfolgte eine Reihe von Rückschlägen, durch welche die errungenen Erfolge grösstentheils wieder verloren gingen. Das erste Unglück war Piccolomini’s Tod, welcher plötzlich am 9. November 1689 in Prischtina starb. Sein Nachfolger im Commando war der Herzog von Holstein, der durch hartes Benehmen, willkürliche Steuererhebungen und Nachsicht gegen die Ausschweifungen
1. Voyage de la Grèce III, S. 162. — Itinéraires I, S. 205.
![]()
116
seiner Truppen die Albanesen von sich und den Türken wieder zuwandte [1]. Doch gelang es ihm, ein Heer von 6000 Türken, welches die Pascha’s von Skopia und Sophia bei Stippo (?) gegen ihn sammelten, am 27. November auf das Haupt zu schlagen. Aber in demselben Winter zog ein neues türkisches Heer gegen das Amselfeld, nahm das feste Schloss Katschanik und schlug den Obristen Freiherrn von Strasser in der Nähe desselben auf’s Haupt. Der Obrist, den Albanesen ohnedies verhasst, hatte vor Kurzem einen der Ihrigen um geringer Ursache willen hin richten lassen. Nachdem er nun sein nur 2800 Mann zählendes Corps, dem Käthe der übrigen Kriegsobersten zuwider, den 12,000 Türken in weiter Ebene ohne den geringsten Anhaltspunct gegenüber gestellt hatte, beschimpfte er einen der albanesischen Führer, der ihn auf das Unzweckmässige seiner Anstalten aufmerksam machte, gerieth mit ihm darüber in Wortwechsel und durchschoss ihm mit der Pistole den Arm. Deshalb verliessen ihn die ergrimmten Albanesen während der Schlacht und gingen zu den Türken über. Vom Feinde wüthend angegriffen, thaten die deutschen Truppen Wunder der Tapferkeit, wurden jedoch von der Ungeheuern Ueberzahl des Feindes zermalmt. Der tapfere, aber unbesonnene Strasser, der zu spät bemüht war, durch Beweise ausserordentlichen Muthes seinen Fehler wieder gut zu machen, büsste die Schuld seiner Rauhheit und Fahrlässigkeit mit dem Tode. Mit ihm fielen der heldenmüthige Prinz von Hannover, nachdem er neun Feinde mit eigener Hand erlegt hatte, dann die Grafen Styrum, Gronsfeld und Auersperg, Jünglinge, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigten. Nur mit wenigen Kriegern rettete sich Obristlieutenant Graf Solar mit Hilfe der Nacht in die dichten Wälder [2]. Auf die Nachricht von diesem Unglücke räumte der Herzog von Holstein alsbald Prischtina, in welchem grosse Vorräthe aufgehäuft waren, und zog sich nach Nisch zurück, wo alsbald General Veterani, Piccolomini’s Nachfolger im Commando, welcher, obwohl noch an seinen Wunden leidend, an den Ort der Gefahr geeilt war, den Oberbefehl übernahm, den entmuthigten
1. Nach unserer Kenntniss der Verhältnisse wäre dieser Umschlag der Gesinnung auch durch die humanste Behandlung nicht zu verhindern gewesen, denn sein HauptGrund liegt in der Unmöglichkeit, allzuhoch gespannte Erwartungen zu befriedigen.
2. Sie sind gänzlich verschwunden, ebenso wie in der Thalebene der vereinigten Morawa, welche nach Schilderung der Kriegsberichte des Jahres 1689 mit dichten Wäldern bedeckt war; ein Beweis, dass das Amselfeld jetzt stärker als damals bevölkert ist.
![]()
117
Geist seiner Truppen wieder aufrichtete und dem Feinde entgegen ging, der sich bei seiner Annäherung zerstreute. Veterani bezog hierauf die von den kaiserlichen Truppen innegehabten Quartiere von Prischtina und Prisieni von neuem, aber mit welch’ schwachen Kräften! Er hatte im Ganzen nur 15,000 Mann unter seinen Befehlen, und von diesen musste er 4000 Mann als Besatzung der Festung Nisch zurücklassen. Diese zweite Besetzung des Amselfeldes durch die kaiserlichen Truppen scheint jedoch nicht von langer Dauer gewesen zu sein, weil bald darauf der Fall von Nisch und Belgrad den Kriegsschauplatz an die Südgrenze von Ungarn verlegte.
Wir entnehmen diesen Daten die interessante Notiz, dass schon im Jahre 1689 Dardanien eine zahlreiche und streitbare albanesische Bevölkerung hatte, denn dass die hier figurirenden Albanesen dem kaiserlichen Heere aus Altalbanien zugezogen sein sollten, dünkt uns im höchsten Grade unwahrscheinlich. Die Frage, ob diese Albanesen aber Christen oder Muhammedaner [1] waren, wird in dem erwähnten Buche nicht gelöst. Die Herausgabe der über den dardanischen Feldzug der kaiserlichen Truppen vorhandenen Quellen würde kostbare Beiträge zur nähern Kenntniss dieser Gegenden und ihrer Bewohner liefern und zugleich von grossem Interesse für unsere Kriegsgeschichte sein, da in ihnen Namen wie Starhemberg und Veterani figuriren, und Niemand erschiene hiezu berufener, als der Biograph des ersteren.
XVII. Das Amselfeld.
Wir übernachteten in dem geräumigen Post-Chane, welcher einem Albanesen gehört, dessen Aeusseres mehr auf einen Palikarenchef als auf einen Wirth hindeutet, und fuhren am andern Morgen zwei Stunden lang das Rinnsal des Lepenatz aufwärts dem Amselfelde zu, dessen äusserste südliche Böschung wir in der Falte eines in den Lepenatz mündenden Regenbaches erstiegen. Doch vereitelte das über Nacht eingetretene neblige Regenwetter jede Möglichkeit, uns so genau, als wir es wünschten, über den Bau dieser interessanten Gegend zu orientiren, denn alle Höhen waren bis zur Wurzel verhängt, und blieben es leider während unseres ganzen
1. Ueber den Hass der muhammedanischen Albanesen gegen ihre osmanischen Glaubensbriider, s. des Verfassers Albanesische Studien passim.
![]()
118
Aufenthaltes, und selbst der Anblick der Ebene wurde häufig durch Nebelschichten verkümmert, die auf derselben herumzogen.
Dieses Flachland scheint ein langgestrecktes Viereck zu bilden, welches mit seiner schmalen Seite bis an den nördlichen Fuss der alpinen Kette des Schar reicht, da wo sie, wie mit letzter Anstrengung zur majestätischen Pyramide der Ljubatrn [1] aufsteigend, von dieser nach Norden, Osten und Süden plötzlich abfällt und nur vermittelst der Hügelmassen, durch welche sich der Lepenatz gewaltsam Bahn gebrochen, mit dem Karadag zusammenhängt. Dieser gewaltige, das ganze Flachland beherrschende Kegel war für uns leider nur an dem Abende sichtbar, wo wir von Gilan nach Katschanik zurück fuhren.
In dieses Flachland [2] theilen sich zwei Flussgebiete, denn im Süden läuft der Lepenatz, den Schar im Norden und Osten umkreisend, nebst der Neredimka dem Wardar zu, während die grössere nördliche Hälfte von der Sitnitza in der Richtung von Südwestsüden nach Nordostnorden durchströmt wird und als Nebenfluss des Ibar zur Morawa, mithin zum Donaugebiete gehört. An einer Stelle sind jedoch diese beiden Gebiete durch eine Bifurcation, die einzige uns bekannte des ganzen Donaugebietes, mit einander verbunden. Denn bei dem etwa 1 1/2 Stunden von den Quellen der Neredimka gelegenen Weiler Wate gibt dieser Bach einen Theil seiner Wasser zur Treibung einer Mühle her, und läuft dieses Mühlwasser in den Sumpf von Sasli, während der Hauptbach dem Lepenatz zufliesst, welches Verhältniss uns von einem Kawassen in Gilan in der Form beschrieben wurde, dass ein Theil des Neredimkawassers in das schwarze, ein anderer in das weisse Meer fliesse, unter welch’ letzterem Namen die Türken bekanntlich das mittelländische Meer verstehen.
Der vorerwähnte Sumpf von Sasli scheint der Rest des grossen See’s zu sein, welcher in der Urzeit das Amselfeld bedeckte [3], und welcher merkwürdiger Weise doppelte Abflüsse hatte, nämlich einen südlichen (Lepenatz) und einen nördlichen (Sitnitza). Dieser Sumpf
1. Die albanesische Namensform ist Ljubetén.
2. Indem wir das Gebiet des Lepenatz und der Sitnitza als ein Ganzes betrachten, folgen wir dem Eindrücke, welchen das Land nach der Ersteigung der nördlichen Böschung des Lepenatz-Rinnsales auf uns machte. Boué trennt dieses von dem Amselfelde, dessen Länge er auf 9—10 und dessen Breite auf 3 Stunden im Süden und 1 1/2 Stunden im Norden angibt. Auch reicht der Name Amselfeld schwerlich bis zum Fusse der Ljubatrn.
3. Boué, Itinéraires I, S. 200.
![]()
119
zieht sich an dem westlichen Ende des niederen, flachgeböschten Buckels hin, welchen als letzten Ausläufer die Hauptkette des Karadag in nördlicher Richtung schickt. Dieser Buckel bildet die Wasserscheide zwischen den Quellgebieten der Sitnitza und der bulgarischen Morawa ; er möchte an seiner niedrigsten Stelle kaum 150 Fuss über den Wasserspiegel der Morawa aufsteigen. Es fehlt uns leider an jeder Verbindungslinie für beide Gebiete in dieser Gegend, doch dürfte die Entfernung zwischen dem Dorfe Widdin, bei welchem die Morawa aus den Bergen in die Ebene tritt und westöstlichen Lauf annimmt, von dem Rinnsal der Sitnitza schwerlich über 1 1/2 Stunde betragen. Ueber die Ausdehnung des Sumpfes von Sasli konnten wir gleichfalls keine sichere Auskunft erhalten. Das ganze Rinnsal der oberen Sitnitza soll sumpfig sein, der eigentliche Sumpf aber auch zur Sommerzeit bis zum Dorfe Rupofze reichen.
Jener Höhenbuckel steht gegen Norden mit den felsigen Hügelzweigen in Verbindung, welche eine von den Quellen der Kriwa Rjeka südwärts laufende, und dort Koznik Planina genannte Kette gegen Westen ausschickt, und deren Abfälle in die Ebene eine ziemlich gleichförmige Linie von Norden nach Süden und von Nordwestnorden nach Südostsüden bildet.
Der Westrand des Amselfeldes wird von einer wandartigen Kette gebildet, welche parallel mit dem Ostrande läuft, und deren Kamm, wenn wir richtig sahen, eine wenig undulirte gerade Linie bildet, welche sich 500 bis 600 Fuss über die Ebene erheben mag und durch den Golesch (Kahlberg) abgeschlossen wird, welcher in der Form eines breitgestutzten Kegels etwas in die Ebene einspringt und dieselbe etwa um 1000 Fuss überragen mag. Dieser Golesch scheint die Spitze eines Winkels zu bilden, welchen der westliche Thalrand beschreibt, denn von ihm an nimmt das Amselfeld nordwestliche Richtung an und wird durch einen in gleicher Richtung laufenden Höhenzug in zwei Thäler gespalten. In dem östlichen Thale fliesst die Sitnitza, welche hier den von Osten kommenden Lap aufnimmt, und diese Mündungsgegend ist das berühmte Schlachtfeld von Kossowo, auf welches wir unten zurückkommen werden.
Der Weg von Katschanik nach Prischtina erreicht erst bei dem Dorfe Babusch den wagerechten alten Seeboden, nachdem er den letzten in der Ebene laufenden sanftgeböschteu Höhenzug etwas südlich von diesem Dorfe überstiegen hat, welches etwa fünf Stunden von Katschanik und sechs Stunden von Prischtina entfernt ist, und kreuzt bald darauf die Sitnitza. Dieses Dorf Babusch ist nur von einer einzigen, auf zehn Häuser vertheilten Familie bewohnt, welche
![]()
120
ihren Ursprung bis zu der Schlacht von Kossowo (1389) zurück datirt, denn damals erhielt ihr Ahnherr für wichtige Kundschafterdienste, welche er dem Sultan Murad dem Ersten leistete, zur Belohnung dieses mehrere Stunden im Umfange haltende Dorf als steuerfreien Besitz, und seine Nachkommen sollen dies Privilegium der Steuerfreiheit erst in Folge der durch den Tansimat im Steuerfache eingeführten Reform verloren haben.
Wir übernachteten in dem eine halbe Stunde nördlich davon gelegenen Chan von Rupofze, und nahmen von ihm aus nicht den geraden Weg nach Prischtina, sondern beugten östlich nach dem Kloster von Gratschanitza ab, welches eines der berühmtesten des alten Königreiches Rascien ist, dessen Schwerpunct das Amselfeld und die östlich anstossende Ebene des weissen Drin (Metoja) war. Der Name Rascien scheint aber hier Landes ausgestorben zu sein und sich nur noch bei den Deutschen und Ungarn erhalten zu haben, welche die in dem Banate sitzenden serbischen Einwanderer Raizen nennen. Die Serben haben ihm den Namen Alt-Serbien (Stara Srbia) substituirt, doch konnten wir über die Ausdehnung, welche sie diesem Namen geben, nicht klar werden. Ausser den genannten Ebenen gehört jedoch auch der Kessel von Nowi Pazar sicher zu demselben.
Wir hielten einen Trupp Bauern an, welche den Feiertag dazu benützten, um sich in einem Nachbardorfe mit ihrem Zehentpächter zu besprechen, und fragten sie über die Umgegend aus. Sie zeigten trotz des schlechten Wetters die grösste Bereitwilligkeit, und uns frappirte die wahrhaft theatralische Scene, wie diese acht oder neun Mann stets mit einem Munde und zu gleicher Zeit die Fragen des Majors beantworteten, der in weitem schwarzen Regenmantel, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen, auf seiner hochbeinigen Stute sass, und wie alle Arme zu gleicher Zeit nach den Orten zeigten, welche der Major angab. Ein vollendeterer Chor liess sich nicht denken. Der albanesische Instinct zeigt sich dagegen aristokratischer, denn für eine albanesische Mehrheit steht in der Regel nur der Aelteste Rede und Antwort und verhalten sich die Andern still.
Als aber der Kutscher einen Wegweiser durch den Sumpf begehrte, wurde unser Chor plötzlich schweigsam und suchte so rasch als möglich von uns loszukommen. Aus Mitleid mit den freundlichen Leuten begnügten wir uns jedoch mit der Beschreibung der Linie, die wir zu nehmen hatten. Bald zeigte es sich jedoch, dass unser Mitleid übel angebracht war, denn der Kutscher wurde bedenklich, und Pferde und Wagen sanken immer tiefer ein.
![]()
121
Da erblickten wir einen andern Bauer, der nicht weit von uns, aber in entgegengesetzter Richtung durch den Sumpf zog. Wir riefen ihn herbei, und er erklärte, dass er nach einer Kuh suche, jedoch nicht sicher sei, ob sie sich verlaufen habe oder von den Albanesen oder vom Wolfe geraubt sei. Wir fragten ihn, ob sein Vieh gewohnt wäre, sich nur nach der von ihm eingeschlagenen Richtung zu verlaufen, was er mit verwunderten Augen verneinte. Wir meinten also, dass er es eben so gut mit unserer Richtung versuchen könne und er dafür ein Trinkgeld erhalten solle. Er antwortete mit einem Blicke, worin deutlich zu lesen war, warum bietet ihr Geld ohne Noth, ich muss ja, wenn ich nicht will; doch erwiderte er einfach; „wohl, Herr“, und ging mit. Der Major nahm ihn sogleich in’s Examen, und erhielt von ihm die erste Auskunft über die erwähnte Bifurcation der Neredimka, aber in so verworrener Weise, dass wir ihm fort und fort mit Fragen zusetzten, bis er endlich in wahrer Herzensangst den Zeige- und Mittelfinger gabelförmig auseinander sperrte und diese hinhaltend ausrief: „Sieh, Herr, bei Wate macht der Bach so“, da dämmerte es bei mir, und als der Bauer aus den Fragen merkte, dass ich ihn verstanden, da lachte er aus vollem Halse und hielt mir beständig seine Fingergabel hin, indem er Christum und die Heiligen zu Zeugen anrief, dass er die Wahrheit sage.
Unterdessen ging es bis über die Axen durch den Sumpfbrei, aber ohne Bedenken, da der Bauer versicherte, dass wir auf dem Wege seien, und wirklich kamen wir auch bald auf festen Grund, indem wir uns den Wurzeln des östlichen Bergrandes näherten, und erreichten nach Kreuzung verschiedener Thäler und die sie bildenden Höhen das Kloster. Es liegt an dem linken Ufer des Gratschanitzabaches, welcher eine Viertelstunde östlich davon aus seinem Berggebiete in einen sich gegen Westen mit der Ebene vereinigenden Thalbusen tritt und in der Richtung von Osten nach Westen gleich den übrigen Bächen, die wir passirt hatten, der Sitnitza zufliesst.
Die Klosterkirche steht in der Mitte des ummauerten und mit mehreren Gebäuden besetzten Hofraumes, und ist im byzantinischen Style erbaut; sie bietet jedoch mehrere uns bis dahin noch nicht vorgekommene Eigenthümlichkeiten. Jede ihrer vier Fronten zeigt nämlich drei Glieder, von denen das untere drei Rundbogen enthält, deren mittlerer um die Hälfte höher ist, als die beiden äusseren. Ueber diese vier Mittelbogen steigen als zweites Glied vier Spitzbogen auf, und das durch sie gebildete Viereck trägt die Hauptkuppel als drittes Glied. Auf den Winkeln, welche die unteren
![]()
122
äusseren Rundbogen bilden, stehen vier Nebenkuppeln, welche jedoch für unseren Geschmack zu isolirt aus derselben aufsteigen und der nöthigen Verbindung mit dem Unterbaue der Hauptkuppel ermangeln.
Das Innere ist durch die unverhältnissmässige Höhe auffallend, zu welcher die senkrechten Pfeiler der vier Wölbungen aufsteigen, im Vergleiche zu welcher die kleinen Verhältnisse der auf ihnen ruhenden Hauptkuppel keinen harmonischen Eindruck machen. Bei entsprechenden Proportionen bringen diese nischenartig aufsteigenden schmalen Kundbögen grosse Schlankheit, ja Zartheit in den Bau, und als Muster dieses Styles schwebt uns stets eine leider halbverfallene kleine Kirche in Alt-Mistra vor.
Den drei äusseren Bogen der Façade entsprechend, hat das Allerheiligste (Templon) der Kirche drei durch Mauern unterschiedene Nebenabtheilungen. In der rechten Nebenabtheilung ist die rechts vom Eingang befindliche Mauer mit einer ungeheuren slavischen Inschrift bedeckt, welche mit schwarzer Farbe auf die weisse Kalkfläche gemalt ist und aus 82 Zeilen und jede Zeile aus circa 130 Buchstaben auf 7 Fuss Breite besteht. Sie soll die Stiftungsurkunde des Klosters enthalten, und von dem Kral Milutin, der für dessen Stifter gehalten wird, ausgestellt sein. Der ungeheure Umfang dieser Inschrift hätte uns bei besserem Wetter vielleicht nicht von ihrer Copirung abgeschreckt, aber bei dem obwaltenden wäre eine solche Unternehmung eine Thorheit gewesen. Auch erzählten uns die Mönche, deren das Kloster mit Einschluss des Abtes nur vier zählt, dass die Inschrift im Anfänge des verflossenen Sommers von einem Reisenden, der sich Stephan nannte, bereits copirt worden sei. Die Arbeit habe acht Tage gedauert, und er habe sich dazu ein Gerüste gebaut. Wir hatten von diesem Reisenden bereits in dem Kloster Sweti Otaz gehört, das er gleichfalls besuchte, doch hier wie dort wusste man nur seinen Taufnamen anzugeben, mit dem Zusatze, dass er geläufig bulgarisch gesprochen und ganz allein ohne alle Begleitung gereist sei.
In derselben Abtheilung finden sich, der Inschrift gegenüber, auf einer die Fussstütze des Altars bildenden viereckigen, roh gearbeiteten Ara mehrere lateinische Buchstaben eingegraben. Im Chalkidikum der Kirche steht ferner eine grössere viereckige Ara, welche auf zwei Seiten Grabinschriften aus der heidnischen Römerzeit trägt. Am Plingange liegt ein Grabstein aus derselben Zeit, und in die P’undamente der Kirche ist ein ähnlicher in der Weise eingemauert, dass nur einige Buchstaben seiner Zeilenanfänge sichtbar
![]()
123
sind [1]. Wir vermuthen, dass sie von der Station Vicianum, der grossen Militärstrasse, welche von Naissus nach Lissus führte, und die wir unten näher besprechen werden, nach dem Kloster gebracht worden sind, denn wenn Vicianum mit dem Dorfe Schaglawitza zusammenfällt, so war dies kaum eine kleine Stunde von Gratschanitza entfernt.
XVIII. Prischtina.
Vom Kloster fuhren wir nach der 1 1/2 Stunde nordwestnördlich gelegenen Stadt Prischtina, wobei wir abermals mehrere Thäler und Ausläufer kreuzten, denn sie liegt weder in der Ebene, noch an ihrem Rande, sondern ist in ein Nebenthal derselben an der Stelle eingekeilt, wo sich dasselbe gabelt, und wird von den aus den beiden Zweigthälern kommenden Bächen durchflossen, welche sich etwas unterhalb vereinigen. Die Stadt liegt nach unseren Messungen 1776 Fuss über dem Meere. Zwölf Minaret's und ein Stadtuhrthurm überragen die Häusermasse.
Prischtina [2] (Prischt, slav. Beule, Hübel) ist nach Monastir der Hauptwatfenplatz der westlichen Hälfte der Halbinsel, und vermuthlich dürfte seine Lage zwischen den gleich unruhigen dardanischen und gegischen Albanesen und die Nachbarschaft des Kessels von Nowi Pazar, welcher die einzige Verbindung zwischen Bosnien und dem übrigen Reiche bildet und über welchen die Serben bereits öfter den Montenegrinern die Hand zu reichen versucht haben, bei der Wahl dieses militärischen Centralpunctes massgebend gewesen sein. Die Stadt wimmelt daher auch von Militärs aller Waffen, doch bildet sie kein administratives Centrum, sondern untersteht dem Pascha von Prisrend, und ist der Sitz eines einfachen Mudirs. Der gegenwärtige Functionär, ein kleiner, alter Mann, überhäufte uns mit Aufmerksamkeiten, aber mit den Militärautoritäten kamen wir in keine nähere Berührung.
Am Morgen nach unserer Ankunft (1. November) sahen wir Alles weiss überzogen, denn über Nacht war fusshoher Schnee gefallen. Der Winter war also auf dieser Hochebene eingezogen,
1. Die Abschriften dieser Steine sind in den Beilagen der ersten Ausgabe abgedruckt.
2. Nach Pouqueville’s Voyage de la Grèce, III, 160, der sich auf die Ragusaner Chronik von Luccari libr. I, p. 25 beruft, hiess die Stadt früher Plislava.
![]()
124
und nach den Aussagen der Eingebornen zeigt er sich gleich bei seinem ersten Auftreten meist hartnäckig, und war daher eher dessen Zu- als Abnahme in Aussicht. Wir mussten also unsern Plan aufgeben, von hier aus in das gebirgige Dardanien einzudringen, und darauf bedacht sein, rasch in südlichere, niedriger gelegene Gegenden zu kommen. Wir blieben zwei Tage in dem Hause des Vorstehers der Stadt, dessen finstere Räume nicht geeignet waren, unsere Stimmung zu erheitern, doch wurde es uns insoferne interessant, als die alte Mutter des Vorstehers erzählte, dass hier nur selten europäische Reisende herkämen·, die letzten, deren sie sich erinnere, seien zwei junge Franzosen gewesen, die vor etwa achtzehn Jahren zu Lebzeiten ihres Mannes, der gleichfalls Vorsteher war, eingekehrt seien. Als ich ihr die Namen Boué und Viquesnel nannte, wollte sie sich nur des ersteren erinnern, und ihre Personalbeschreibung war zutreffend. Dies ist die einzige Spur, welche wir von den Männern auffanden, denen die Wissenschaft die erste nähere Kenntniss dieser Länder verdankt, denn bis zu welchem Grade dieselben vor ihnen unbekannt waren und sind, dies zeigt die Nachlese, welche sie uns zurückliessen, und wie wenig erschöpfend ist diese, wie Vieles mussten wir nicht unsern Nachfolgern hinterlassen !
Nachdem uns der Winter das Gebiet der dardanischen Bergstämme verschlossen hatte, waren wir in Prischtina bemüht, wenigstens so viel als möglich über sie zu erfragen, und wir erfuhren hier zum ersten Male eine geographische Haupteintheilung des im Osten des Amselfeldes liegenden Landes, in die nördliche Landschaft Lab und die südliche Golak. Doch ist es uns nicht wahrscheinlich, dass aus diesen Elementen die Zusammensetzung Lab Golab entstanden sei, mit welcher die dardanischen Albanesen von ihren Brüdern in dem alten Albanien bezeichnet werden, weil, wie wir bereits früher bemerkt, die letzte Form mit Golubinje, dem alten Namen von Wranja, Zusammenhängen dürfte. Gol ist im Slavischen nackt, und Golak bedeutet daher eben so wie Golesch, einen nackten Berg, oder wohl genauer einen Complex von nackten Bergen ; es wäre möglich, dass der felsige Charakter des Mrkonje und seiner beiden Nachbarn diese Bezeichnung der Landschaft veranlasst, jedoch konnten wir hierüber eben so wenig Sicheres erfahren, als über die geographische Ausdehnung derselben, obwohl wir überzeugt sind, dass sich deren Grenzen an Ort und Stelle mit ziemlicher Genauigkeit feststellen lassen.
Die Landschaft Lab dagegen hat ihren Namen von dem gleichnamigen Flusse, einem Nebenflüsse der Sitnitza, erhalten, und begreift
![]()
125
also das Gebiet desselben, über welches wir uns in Prischtina so viel als möglich unterrichten liessen, weil es noch gänzlich unbekannt ist.
Jede dieser Landschaften zerfällt in zwei Unterabtheilungen, was wir aus folgender Notiz schliessen: Zum oberen Golak gehören 19 Dörfer, und diese halten ihre Volksversammlungen bei der Moschee von Prapaschitza, und die 21 Dörfer des unteren Golak versammeln sich bei dem Dorfe Sfirtza. Dagegen kommen die 20 Dörfer von Prischtina bei Orlan zusammen, und die 22 Dörfer von Lab in Podujewo. Aus dieser Notiz ergiebt sich ferner, dass auch die dardanischen Albanesen eben so gut dingen, wie die Malissor im Mutterlande, aber in Prischtina fand sich leider kein Frater Gabriel, um uns das Wesen dieser dardauischen Volksversammlungen so klar und erschöpfend zu schildern, wie die im albanesischen Alpenknoten [1]. Wir konnten nichts Näheres über dieselben erfahren.
Die dardanischen Albanesen gliedern sich gleich den Malissor und Mirediten im Mutterlande nach Stämmen, doch ergiebt sich die Schwächung des Stammverbandes schon aus dem Umstande, dass die Blutrache hier nicht Stammes-, sondern Familiensache ist, und zwar die Pflicht der Rache nur dem nächsten Verwandten des Gemordeten obliegt, und ebenso die Blutschuld nur an dem nächsten Erben des Mörders haftet. Ob aber der Grundsatz: „wer erbt, der rächt“, so unbedingt von der Sitte geheiligt ist, als man uns angab, möge dahin gestellt bleiben. Noch auffallender klang uns eine andere Angabe in Deditsch, welche von Albanesen in Prischtina bestätigt wurde, dass nämlich bei ihnen die Erbtochter auch den Grundbesitz des Vaters erbe. Dieser kommt sonach durch deren Heirath an einen anderen Stamm, denn trotz der grossen Zerstreuung der einzelnen Stämme gestattet auch hier die Sitte keine Heirath zwischen Angehörigen desselben Stammes, was jedoch in Prischtina als unbedingte Regel geleugnet wurde. Ist aber die Erbtochter grundbesitzfähig und muss sie aus ihrem Stamm heraus heirathen, so fehlt im Rechtsbewusstsein bereits ein Hauptattribut des Stammes, nämlich die Idee des geschlossenen Stammgebietes.
Der Stamm heisst hier wie im Mutterlande Fis, und dieses Wort ist offenbar mit dem griechischen φύσις verwandt. Die erblichen Stammhäupter heissen dagegen Nacer, eine Bezeichnung, welche uns im Mutterlande nicht vorkam ; vielleicht ist sie türkischen Ursprunges.
1. S. Albanesische Studien I, S, 173 sq.
![]()
126
Die Hauptstämme sind beiläufig in folgender Weise über das Land vertheilt: Von den 22 Dörfern des Lab gehören 20 den Element! (die zwei übrigen gehören den Betusch), sie erstrecken sich von Podujewo bis nach Kurschumlje und bewohnen die meisten Dörfer um Deditsch, dagegen finden sich in den Bezirken von Wranja und Gilan keine Elementen Diese betrachten sämmtlich die Elementer, welche in dem albanesischen Alpenknoten sitzen und sich zum katholischen Glauben bekennen, als ihren Mutterstamm, von welchem zu verschiedenen Zeiten einzelne Familien nach Dardanien gezogen sind [1]). Die Graschnitsch sitzen hauptsächlich in und um Prischtina und bilden fast die ganze muhammedanische Stadtbevölkerung, denn ausser ihnen giebt es dort nur vierzehn Häuser Emire, welche sich als einen Zweig des in Nowo Brdo sitzenden Mutterstammes betrachten. Diese Emire sind die einzigen Muhammedaner des Landes, welche aus Asien stammen, oder um nach Ortsgebrauch zu reden, sie sind die einzigen Osmanli im Lande.
Ober- und Unter-Goloku sind Hauptdörfer der Graschnitsch im Bezirke von Prischtina, wo sie den Elementern so ziemlich die Wage halten. Auch wiegen sie iu und um Leskowatz und Mitrowitza vor, und finden sich deren auch in dem Ereise von Wranja.
In dem Kreise von Leskowatz leben, mit den Graschnitsch vermischt, Zweige der Stämme Sob (Heu), Bensch und Gasch. Die Sob überwiegen ferner in dem Morawitzathale ; fast alle Bewohner des Karadag sind Berisch. Gasch finden sich auch in der Landschaft Masuritza, deren grösster Theil jedoch den Graschnitsch gehört. Im Districte von Leskowatz bewohnen die Gasch sechs Dörfer, stehen aber mit ihren Stammverwandten in Prischtina und Wranja in keinerlei Verbindung. Ihr Chef war früher der durch seine Tapferkeit landbekannte Latif Aga, jetzt ist es sein ältester Sohn, Reschid Aga, dessen Bruder Emin die aus fünf Mann bestehende Garnison des Wachhauses von Lebana befehligt. Einen Theil dieser Notizen verdanken wir diesem Emin und einem seiner Untergebenen Namens Haidar, welcher uns deswegen auffiel, weil er der einzige Albanese war, der uns durch seine Bewegungen verrieth, dass er andern Wesen Herberge gewährte. Man nannte uns
1. Von diesen Klementern stammen auch die in den Dörfern Ninkintze und Herkowtze angesiedelten Albanesen, welche am linken Sauufer zwischen Mitrowitza und Schabatz liegen und der Militärgrenze angehören. S. Albanes. Studien I, S. 13.
![]()
127
endlich als Hauptstämme die Gasen, die jedoch überall zerstreut sind, und die Schalj, welche die Hauptbevölkerung des Bezirkes von Wutschitrn bilden und die im albanesischen Alpenknoten sitzenden katholischen Schalj als ihren Mutterstamm erkennen.
Dies möchten die grössten Stämme sein, welche sich nebst einem Dutzend kleinerer in das albanesische Dardanien theilen. Dieselben zerfallen in mehr oder weniger Unterabtheilungen; so zählen z. B. die Berisch sieben Zweige, nämlich: 1. Askjur, 2. Ali Schitscha, 3. Dodo, 4. Murtur, 5. Liwosch, 6. Kutsch, 7. Getz, und diese Zweige spalten sich wiederum in noch kleinere Abtheilungen ; da wir aber über diese Verhältnisse in Dardanien nichts Neues erfahren konnten, so beschränken wir uns einfach auf das hierüber in den Albanesischen Studien [1] Gesagte zu verweisen.
Zur Bestimmung der Seelenzahl der dardanischen Albanesen bietet sich nur ein Anhaltspunct in der uns von dem Generalcommando des Armeecorps von Rumelien gewordenen Mittheilung über die Recrutenzahl, welche die muhammedanische Bevölkerung der das dardanische Albanien bildenden Bezirke bei einer Recrutirung erster Classe in Friedenszeiten in der Proportion von 5 : 100 Militärpflichtigen stellt, und mit welcher auch die einzelnen an Ort und Stelle hierüber eingezogenen Erkundigungen übereinstimmen:
Kurschumlje 39
Leskowatz 84
Wranja 80
Prokop 45
Prischtina und Lab Golak 82
Gilan 83
______________
Zusammen 413
was also im Ganzen 8200 militärpflichtige Albanesen ergibt, weil in jenen Bezirken die muhammedanische Bevölkerung nur aus Albanesen besteht und es in ihnen keine christlichen Albanesen gibt. Hiermit ist aber für unseren Zweck nichts gewonnen, da wir uns überall vergebens nach dem angenommenen Verhältnisse der Gesammtbevölkerung zu den Militärpflichtigen erkundigten.
Glücklicher Weise erhielten wir in Gilan die Notiz, dass die Häuserzahl des nach dieser Stadt benannten Bezirkes im Ganzen 3800 betrage, und davon 2300 albanesisch-muhammedanische und 1500 bulgarisch-christliche seien. Diese Notiz gibt mithin eine annähernde Basis für unsere Berechnung. Bei der früher erwähnten Gewohnheit,
1. I, S, 173 sq.
![]()
128
die Familie so lange als möglich vor Zertheilung zu bewahren, an welcher der Albanese wegen der bei ihm herrschenden Blutrache und seiner Neigung zum Faustrechte noch fester als der Serbe und Bulgare zu halten Ursache hat, glauben wir die durchschnittliche Bevölkerung des albanesischen Hauses wenigstens auf sechs Seelen anschlagen zu müssen, und erhalten nach diesem Anschläge für das dardanische Albanien eine Bevölkerung von etwa 70,000 Seelen.
Wenn wir nun den Flächeninhalt dieses Landstriches auf etwa 80 Quadratmeilen anschlagen, so ergäbe dies beiläufig 900 Seelen auf die Quadratmeile.
Zu den oben angeführten Bezirken gehören freilich mehrere ausserhalb des Lab Golak und der östlich angrenzenden Striche gelegene Landschaften, wie das Morawitzathal, das Qnellbecken der Morawa, und Theile des Amselfeldes, auf der anderen Seite lässt sich aber wohl mit Sicherheit annehmen, dass die den Aushebungen zu Grunde liegenden Listen in diesem kaum halbgezähmten Lande weit unter dem wahren Bestände seiner Bevölkerung geblieben sind, und darum vermuthen wir, dass auch unsere Berechnung eher zu niedrig als zu hoch gegriffen sei.
XIX. Sultan Nlurad’s Grab.
Wenn uns der Winter zwang, von einer Bereisung des unteren Golak oder Lab abzustehen, so wollten wir uns wenigstens nicht von ihm an einem Besuche des berühmten Schlachtfeldes von Kossowo und des Grabes von Sultan Murad hindern lassen. Wir fuhren also am dritten Morgen unserer Ankunft von Prischtina aus durch Wind und Schnee über die letzten Ausläufer der Höhen, welche den Band des Amselfeldes bilden, auf der Strasse, welche nach Nowi Pazar führt, eine gute Stunde gegen Norden, und erreichten dann einen Busen, welchen die Ebene gegen Osten bildet und durch die der Lab der Sitnitza zufliesst. Wir liessen vorerst die Grabstätte zur Linken und fuhren quer durch den Busen zum Fluss bei der Brücke, über welche die Strasse führt. Dies war der kälteste Tag unserer Reise, denn als wir unsere Instrumente bei dem Flusse aufstellen wollten, um dessen Höhe zu bestimmen (1591 Pariser Fuss), fand sich, dass trotz aller Umhüllungen, mit welchen wir uns versorgt hatten, unsere Glieder so steif geworden waren, dass sie uns für die Beobachtung fast den Dienst versagten und es längerer Exercitien bedurfte, um
![]()
129
sie für die Stellung der Instrumente gelenk zu machen, und doch zeigte der Thermometer nur etwas weniges unter 0 Grade. Wäre der Verfasser allein gewesen, so hätte er dieses mit der Temperatur ausser Verhältniss stehende Kältegefühl der Verweichlichung seiner Haut durch den langen Aufenthalt in dem warmen Griechenland zugeschrieben, allein Major Zach, welcher aus Serbien kam und zwei Winter durch gegen die Ungarn zu Felde gelegen hatte, litt ebenso, und Herr Gottschild, welcher Sachsen zum ersten Male verlassen hatte, behauptete, in seinem Leben keine ähnliche Kälte empfunden zu haben. Nach zahlreichen Beobachtungen glauben wir überhaupt annehmen zu können, dass das Gefühl von Hitze und Kälte von dem Thermometerstande weit unabhängiger ist, als man gemeinhin annimmt. Weil man die Hitze mehr oder weniger empfindet, tritt man in der Erwartung grosser Veränderungen vor den Thermometer, und siehe, sein Stand ist genau der alte, aber es ist seit der letzten Beobachtung windig oder windstill geworden und dieser Wechsel hat das Wärmegefühl des Körpers verändert. Hiermit erklärt sich jedoch die Möglichkeit noch nicht, dass Menschen im Süden bei einem Kältegrade erfrieren, welcher im Norden für milde gilt, und diese Erscheinung ist um so auffallender, als nach unsern Erfahrungen diese Todesart im Süden Verhältnissmässig häufiger ist, als im Norden, und der griechische Bauer z. B. mehr gegen die Kälte abgehärtet sein sollte, als der deutsche, weil er gegen sie weit weniger geschützt ist. Wir glauben, dass diese Erscheinung die Aufmerksamkeit der Sachverständigen verdiene, denn mit der Annahme der grösseren Feinheit und Eindringlichkeit der südlichen Luft, durch welche mau dieselbe gemeinhin zu erklären sucht, scheint uns an sich wenig gesagt zu sein.
Der Lab ist weitaus der bedeutendste der Nebenflüsse der Sitnitza, er entspringt kaum zwei Stunden von der serbischen Grenze entfernt auf den Südosthängen des Kopaonik, von welchem aus die ihn von den südlichen Zuflüssen der Toplitza, d. h. der Kakowitzka, Bainska und Kostanitza trennende Wasserscheide gegen Osten nach der Kadankette läuft und zugleich die Grenze zwischen den Bezirken von Kurschumlje und Prischtina zu bilden scheint. Die zwischen diesen Städten laufende Fahrstrasse erreicht das Labthal bei Podujewo, welches halbwegs zwischen beiden liegt und der Versammlungsort der Albanesen der Lab-Landschaft ist, und läuft fünf Stunden längs dieses Flusses. Drei Stunden südlich von Podujewo mündet der bedeutendste Nebenfluss des Lab, d. h. die von Nordosten kommende Brwenitza, an welcher Orlan, der Versammlungsort der Albanesen
![]()
130
des Districtes von Prischtina, liegt. Die Länge des Lab von seinen Quellen bis zur Mündung mag nach den uns gewordenen Angaben ungefähr dreizehn Stunden betragen. Er mündet etwa drei Viertelstunden nordwestlich von der erwähnten Brücke in die Sitnitza.
Von der Brücke des Lab wandten wir uns rückwärts zu der eine halbe Stunde südlich, etwa fünf Minuten westlich von der Strasse gelegenen Grabstätte von Sultan Murad. Es ist dies eine kleine, mit dem Halbmond gekrönte Moschee von sehr modernem Aussehen, umgeben von mehreren kleinen, aber schmucken Nebengebäuden, iir welchen der Schech wohnt, welcher zum Aufseher des Grabes bestellt ist. Dieser, ein angehender Fünfziger von blühender Gesichtsfarbe und mit einem auffallend schönen, sorgfältig gepflegten braunen Barte begabt, kam uns auf das Freundlichste entgegen, und führte uns in seine kleine, aber äusserst gemüthliche Wohnstube. Im Kamine brannte ein tüchtiges Kohlenfeuer, die Wände waren mit glänzender grüner Oelfarbe angestrichen und mit Tafeln verziert, auf denen Koransprüche standen. Auf dem Boden lag ein dicker persischer Teppich. Kaum hatten wir uns auf dem Divan niedergelassen, so brachte ein Mohr Wasserpfeifen (Nargilé’s) herbei, und kaum hatten wir von dem ausgezeichneten Tabak, welchen sie enthielten, die ersten Züge eingesogen, so erschien er wieder mit drei mächtigen Schalen; das waren englische Theetassen erster Grösse, daran war kein Zweifel; dass sie aber auch den Trank enthalten könnten, für den sie gemacht waren, das durften wir nicht hoffen, und doch war es so, denn der Heysanduft, den sie ausströmten, erfüllte das Zimmer noch ehe sie in unsere Hände gelangten, und was unsere Ueberraschung auf deu Gipfel erhob, war die Frage des Schech’s: „mit oder ohne?“ indem er auf die neben den Tassen stehende Zuckerdose deutete. Daraufhin fassten wir den Mann etwas schärfer in’s Auge, um etwa unter dem schönen Barte den verkappten Europäer zu entdecken, und wir fürchten in dieser Forschung nicht vorsichtig genug gewesen zu sein, denn er schien unsere Gedanken zu errathen, und begann von freien Stücken zu erzählen, dass er aus Bochara stamme, wo man eben so viel Thee trinke, als in China und Russland, und dass er ihm selbst ein solches Bedürfniss sei, dass er sich den benöthigten Vorrath von Constantinopel jährlich kommen lasse und diesen Bezug bereits dreizehn Male wiederholt habe. Denn er sei bereits dreizehn Jahre der Wächter dieses Grabes, welches er auf Befehl des Sultans neu aufgebaut habe, weil der kleine Bau, welcher früher die Stelle bezeichnete, dem Einsturze nahe gewesen sei. Trotz seines dreizehnjährigen Aufenthaltes hat der Schech
![]()
131
doch keine der dort heimischen Sprachen erlernt; er sprach blos türkisch, und behauptete, dass man in seiner Heimath das Türkische am reinsten spreche. Wir konnten daher nur durch Dollmetscher mit ihm verhandeln, die mitunter den Sinn unseres Gespräches nicht zu fassen im Stande waren, und dadurch die Unterhaltung erschwerten. Trotzdem war dieselbe nicht uninteressant, denn während man uns die Theehumpen dreimal füllte und wir sie eben so oft leerten, erzählte uns der Schech von Bochara, oder fragte uns über Europa aus, welches ihm nicht so fremd war, als der Mehrzahl seiner Collegen, und an dem ihn besonders die neuen Schienenwege interessirten. Wir erfuhren von ihm unter Anderem, dass man von Bochara bis Peking 128 Nachtlager zähle, was also etwas mehr als vier Monate ergäbe. Das erscheint freilich in unserer Zeit sehr viel, erinnert man sich aber, dass Herodot die Reise von Ephesus bis Susa auf 93 Nachtlager berechnet, so wundert man sich, dass von Bochara bis Peking nur ein Drittel weiter sein soll. Von den Chinesen wusste er, dass sie Heiden seien, machte aber den merkwürdigen Zusatz: „doch Gott will es so, und vor ihm sind alle Menschen Brüder, weil er uns alle geschaifen hat". Dass der Mann nicht blos so denkt, sondern auch darnach handelt, erfuhren wir später in Prischtina, denn alle Welt rühmt seine Gastlichkeit, seine Menschenliebe, seine Wohlthätigkeit, vermöge deren er jedem Hilfsbedürftigen ohne Unterschied des Glaubens beispringt, so weit er kann, und daher öfter nach Prischtina kommt, um bei den Autoritäten, bei welchen er in grossem Ansehen steht, zu Gunsten des einen oder andern Christen, der sich an ihn gewandt, Fürsprache zu thun, und in der Regel ist sie erfolgreich. Der Schwarze wollte unsere Tassen zum vierten Male füllen, doch wir fühlten uns nun vollkommen erwärmt und erquickt, und verlangten, das Grab des Sultans zu sehen. Es ist ein einfaches, aber schmuck gehaltenes Mausoleum, dessen weisse Wände mit Papiertafeln unter Glas und Rahmen geschmückt sind, welche in schöner goldener oder schwarzer arabischer Schrift den Stammbaum des Sultans, seinen Todestag und Koransprüche enthalten. In der Mitte steht der Sarg, mit dem Kopfende gegen Westen gerichtet und mit mehreren kostbaren Decken Überhängen. Am Kopfende steht auf einer kleinen dünnen Säule der ungeheure, aus Wulstbändern von weissem Zeuge gewundene Turban, aus welchem auf dem Scheitel eine kleine rothe Spitze hervorragt. Je zwei dicke Wachskerzen stehen am Kopf- und Fussende. Ueber dem Sarge hängt ein aus sechs modernen Oellampen mit Glaskuppeln bestehender Bronzeluster französischer Fabrik,
![]()
132
Das Grab ist indessen nur ein Kenotaph, denn Murad’s Leichnam wurde bekanntlich nach Brussa gebracht und in einer dort von ihm erbauten Moschee beigesetzt [1]. Auf unsere Präge nach den drei je 50 Ellen von einander abstehenden Steinen, welche zum Merkzeichen der Stellen gepflanzt wurden, an welchen der entfliehende Milosch Kobilitsch nach der That seine Verfolger niederstiess und endlich selbst niedergestossen wurde, antwortete man, dass sie nun eingeschneit seien. Ueber den Ort und die Umstände der That weichen bekanntlich die serbischen Quellen von den türkischen und byzantinischen ab; nach den ersteren suchte Milosch Kobilitsch den Sultan am Morgen vor der Schlacht in seinem Zelte auf und stach ihm den Dolch in den Leib, während er sich bückte, um ihm den Puss zu küssen, nach den letzteren geschah dies auf dem Schlachtfelde selbst und während des Kampfes. Nach den ersteren stünde daher das Mausoleum an der Stelle des grossherrlichen Zeltes in dem Lager des türkischen Heeres, nach den letzteren auf dem Kampfplatze. Wie dem auch sei, so bezeichnet das Mausoleum wenigstens im Allgemeinen den Busen der Labmündung in die Sitnitza und das rechte Ufer dieser letzteren als das Schlachtfeld, auf welchem im Jahre 1389 das Schicksal der Halbinsel entschieden und die Macht der Slaven gebrochen wurde, denn der serbische König Lazar wurde bekanntlich in der Schlacht gefangen und vor den Augen des sterbenden Sultans hingerichtet, und Lazar’s Sohn Stephan unterwarf shh dem jungen Sultan Bajesid, indem er ihm Heeresfolge und Tribut versprach.
Die serbische Sage von Milosch Kobilitsch dürfte die nähere Aufmerksamkeit der Mythenforscher verdienen, weil sie Anklänge an den Frauenstreit unserer Niebelungensage bietet, und wir in den Sagen von Marko Kral die Tendenz des indogermanischen Mythus, sich an ausgezeichnete historische Persönlichkeiten zu heften, sich gleichsam wieder zu gebären, auch bei dem slavischen Elemente mit einem schlagenden Beispiele belegen können. Nach dieser Sage hatte König Lazar zwei Töchter, Wukosawa und Mara, von welchen die erstere an Milosch Kobilitsch, die zweite an Wuk Brankowitsch verheirathet war. Beide Schwestern stritten sich über die Tapferkeit ihrer Gatten, und Wukosawa wurde dadurch so gereizt, dass sie ihrer Schwester eine Ohrfeige gab. Die Misshandelte klagte bei ihrem Gemahl und dieser forderte Milosch Kobilitsch zum Zweikampfe, unterlag aber bei demselben, indem
1. Hammer I, S. 180.
![]()
133
er von seinem Gegner aus dem Sattel gehoben wurde. Aus Rache verschwärzte er ihn bei seinem Schwiegervater, dass er ein Verräther sei und es heimlich mit den Türken halte. König Lazar aber reichte beim Abendmahle vor der Schlacht dem Milosch den Becher und sagte: ,,Nimm und trinke auf meine Gesundheit, obgleich es heisst, dass du Verrath treibest“, worauf jener antwortete: „Ich danke dir, der morgige Tag soll meine Treue bewähren“.
Auf dem Amselfelde, erzählen sie nun weiter, dass Wuk Brankowitsch vor der Schlacht auf dem Berge Golesch gelagert habe, und während dieser zu den Türken übergegangen sei, dass von da an aber kein Gras mehr auf dem Golesch wachse, und man ihn darum den Kahlberg heisse. Wuk’s Uebergang zu dem Feinde scheint nicht historisch belegt zu sein.
Milosch war vielleicht aus der Umgegend des Amselfeldes zu Hause, denn als Quellort eines Nebenbaches der oberen Drenitza ward uns das acht Stunden nordwestlich von Prischtina gelegene Dorf Kobilitsch angegeben, doch ist nun Dorf und Umgegend rein albanesisch.
Das Amselfeld aber hat auch noch andere Schlachten gesehen, als jene grosse im Jahre 1389, doch war keine derselben von gleicher Bedeutung für das Schicksal der Halbinsel, denn der Sieg, welchen der Despot Stephan Lazarewitsch im Jahre 1403 über die Türken errang, fällt gleichfalls in ihren Bereich, wenn auch nicht sicher auf die Stelle der grossen Schlacht, und dasselbe gilt von der dreitägigen Schlacht, welche Hunyad im Jahre 1448 gegen Amurad III. verlor [1].
Während unseres Aufenthaltes auf dem Amselfelde waren wir bemüht, uns auch über die zwischen diesem und der Ebene des weissen Drin, der sogenannten Metoja, gelegenen Striche Erklärung zu verschaffen, jedoch gelang es uns nicht, über dieselben vollkommen in's Klare zu kommen. Aus den in der topographischen Beschreibungen enthaltenen Daten scheint sich wenigstens Folgendes zu ergeben : zwischen beiden Ebenen streichen zwei Hauptthäler in der Richtung von Süden nach Norden. Im östlichen Thale läuft die obere Drenitza der Sitnitza zu, nimmt aber später die Richtung von Westen nach Osten an, durchbricht die nördliche Fortsetzung des Goleschberges und tritt aus dem Défilé in die Amselebene, welche hier jedoch durch den früher erwähnten Höhenzug in zwei Thäler gespalten ist. In dem westlichen Thale läuft die Drenitza
1. Boué, Itinéraires I, S. 175.
![]()
134
etwa eine Stunde lang von NWN. nach SOS., erreicht dann die ungeteilte Ebene, und fliesst in dieser gegen Osten der Sitnitza zu, welche sie der Mündung des Granitzabaches fast gegenüber erreicht.
Die untere Drenitza fliesst in dem westlichen Thale, und dass dies in der Richtung von Süden nach Norden geschehen müsse, ergibt sich aus der Angabe, dass sie erst nach zehnstündigem Laufe das Gebiet von Ipek erreicht. Der Bach scheint demnach die Ostgrenze dieses Bezirkes zu longiren. Die untere Drenitza mündet bei Klina in den weissen Drin, welches Dorf zwischen Jakowa und Ipek liegt [1]. Wir vermuten, dass dieser Bach von den Albanesen Miruscha genannt wird, welchen Zufluss des weissen Drin der Weg von Jakowa nach Prischtina kreuzt, und dass [2] dieser Weg eine Zeit lang in dem Thale der oberen Drenitza läuft, bevor er den in der Drenitzakette (welche die Westwand des Amselfeldes bildet) befindlichen Pass kreuzt und in diese Ebene fällt [3].
Der von Süden nach Norden fliessende Bach, welcher die Stadt Mitrowitza bei seiner Mündung in den Ibar durchschneidet, heisst Ljutscha; er hat nur einen Lauf von etwa drei Stunden und hat mit den beiden Drenitzen nichts gemein.
Sämmtliche im Bereiche dieser Bäche liegenden Dörfer wurden uns als rein albanesisch bezeichnet. Da nun auch die Dörfer des Sinitzathales um die Mündung des Lab grosstentheils albanesisch sind, und in der Metojaebene die albanesische Bevölkerung die serbische über wiegen soll, so dürfte sich höchst wahrscheinlich eine ununterbrochene, rein albanesische Verbindungslinie zwischen Bardamen und Altalbanien durch das Gebiet der beiden Drenitzen herstellen lassen.
Welches von den beiden Bevölkerungselementen auf dein Amselfelde über wiege, darüber haben wir kein sicheres Urtheil, da wir mit den in der Nachbarschaft der Strasse gelegenen Dörfern genug zuthun hatten, und uns daher namentlich die an der Westseite der Ebene längs der Drenitzakette gelegenen Dörfer unbekannt geblieben sind. Dagegen ist das Lepenatzgebiet mit Ausnahme der Quellgegend und der Mündung nur von Albanesen bewohnt und dürfte daher auch dieses im Vereine mit dem Karadag und dem nur von Albanesen bewohnten obersten Morawadéfilé zwischen Gilan und Wranja eine
1. Boué, Itinéraires II, S. 115.
2. Ibidem.
3. Boué, Itinéraires I, S. 200.
![]()
135
zweite, rein albanesische Verbindungslinie zwischen Dardanien und dem Mutterlande vermitteln.
Ob dagegen nordwärts der Drenitzen und jenseits des Ibar auch Albanesen sitzen, oder dieser Fluss etwa eine ethnographische Grenzlinie bilde, das konnten wir in Prischtina nicht erfahren.
Was den Eindruck betrifft, welchen das Amselfeld auf uns machte, so war es trotz des schlechten Wetters, in dem wir dasselbe bereisten, ein über Erwarten günstiger; wir glaubten eine Einöde zu linden, und staunten daher über die Masse von Dörfern, die wir zu notiren hatten. Allerdings liegt hier noch viel fruchtbarer Boden brach, aber für fremde Colonien fände sich hier eben so wenig Raum wie in den übrigen von uns besuchten Gegenden der europäischen Türkei.
XX. Janjewo.
Gerne wären wir noch länger in Prischtina geblieben, um unsere Erhebungen zu vervollständigen, aber die Furcht, daselbst eingeschneit zu werden oder mit den Wagen in den sumpfigen Quellgegendeu der Morawa stecken zu bleiben, die wir nicht ungesehen lassen wollten, nachdem wir ihren ganzen Lauf verfolgt, zwang uns, so rasch als möglich aufzubrechen, Wir gönnten uns daher nur noch einen Tag zum nothdürftigen Abschluss unserer Arbeiten und benutzten den darauf folgenden um so eiliger, als er sich milder anliess als seine Vorgänger, um den katholischen Pfarrort Janjewo zu besuchen, dessen Pfarrer uns dringend dazu eingeladen, und von da über Nowo Brdo nach Gilan zu gehen. Unser Weg führte uns abermals über das Kloster von Gratschanitza und am östlichen Rande des Amselfeldes hin, bis zu den Bache von Janjewo, der der Gratschanitza parallel von Osten nach Westen fliessend, wie diese in die Sitnitza mündet, hierauf aber bachaufwärts in die enge Schlucht, in welcher Janjewo versteckt liegt, dessen städtische Häuser dicht auf einander gedrängt an den steilgeböschten Wänden derselben angeklebt sind. Die Wagen bis zu dem zu unserer Aufnahme bestimmten Hause in der Nähe der neuen katholischen Kirche zu schaffen, kostete einige Anstrengung, doch gelang es unter dem willigen Beistände der türkischen Bewohner, denn die katholische Gemeinde war uns mit dem Pfarrer an der Spitze einen andern bequemeren Weg entgegengeritten und kehrte erst anderthalb Stunden nach unserer Ankunft zurück.
![]()
136
Der Pfarrer, ein angehender Vierziger, von kleiner, sehniger Natur, heisst Berisch, und gehört also zu dem grossen, den Karadag bevölkernden albanesischeu Geschlechte. Er ist aus Skodra gebürtig, aber in Rom in der Anstalt der Propaganda gebildet. Er verwaltet diese Pfarrei seit vier Jahren und ist daher vollkommen mit den Verhältnissen der ganzen Gegend vertraut; leider aber konnte der Verfasser seine Ortskenntniss nicht nach Wunsch ausnützen, denn schon unwohl vor seiner Ankunft, überfiel ihn kurz nachher ein so heftiges Kopfweh, dass er kaum die in Arbeit begriffenen Bauten besichtigen konnte und sich dann sogleich niederlegen musste. Der Pfarrer begleitete ihn zwar am nächsten Tage nach Gilan, der Verfasser war aber während der ganzen Fahrt zu leidend, um mehr als die nöthigsten Fragen über die Umgegend stellen zu können. Doch erzählte der ihm über seine interessante Gemeinde und ihre Schwester im Karadag ungefähr Folgendes:
Der Flecken von Janjewo hat 150 katholische Häuser mit 1720 Seelen, 22 albanesisch-muhammedänische und 20 muhammedanische Zigeunerhäuser. Die katholischen Einwohner sprechen das Serbische als Haussprache, und nähren sich von Messinggiesserei. Sie arbeiten ihre Waaren zu Hause, und ziehen dann mit denselben namentlich durch Serbien, Bulgarien, die Walachei und die Moldau. Ihre Fabrikate bestehen vorzugsweise aus Messinglampen, Kirchen- und Hausleuchtern, Ringen und kleinen Kaffeelöffeln, welch’ letztere mit einer schlechten Alliage auf nassem Wege versilbert werden. Die Janjewaner wanderten früher auch südwärts, und durchzogen ganz Macedonien bis Bitolia, Salonik und Seres, sie wurden jedoch von diesen südlichen Absatzmärkten durch die zunehmende Einfuhr vollkommenerer und wohlfeilerer europäischer Fabrikate verdrängt, welche sie auch in ihren nördlichen Absatzbezirken mehr und mehr beengen, so dass die gänzliche Vernichtung der Metallindustrie von Janjewo in nicht ferner Zukunft zu erwarten steht. In dieser Voraussicht bemüht sich Don [1] Berisch, seine Pfarrkinder mehr und mehr dem Ackerbaue zuzuwenden , und sein Einfluss ist nicht nur bei seiner, sondern auch bei der türkischen Gemeinde des Fleckens so gross, dass es ihm glückte, beide Theile über die Vertheilung eines vor der Schlucht gelegenen Striches fruchtbaren Bodens, welchen sie vor Zeiten von einem türkischen Grossen zur Viehweide erstanden hatten,
1. Dies ist der Titel der katholischen Geistlichen auf der ganzen Südosthalbinsel. Don Berisch’s Verdienste wurden von dem päpstlichen Stuhle durch seine Ernennung zum Bischof von Pulati anerkannt.
![]()
137
an die einzelnen Gemeindeglieder zu verständigen, und diese Theilung auf friedlichem Wege zu bewerkstelligen, ein Vorgang, welcher mancher deutschen Gemeinde zum Beispiele dienen könnte, deren Vortheil und Bedürfnisse die Theilung des Gemeindegrundes verlangen, während Vorurtheil und Geistesträgheit widerstreben.
Don Berisch ist aber nicht blos auf die materielle Hebung seiner Gemeinde bedacht, er erwirbt sich auch durch den Bau einer geräumigen Kirche ein Verdienst, welches nur Derjenige in seinem vollen Umfange zu würdigen im Stande ist, der von den tausend Schwierigkeiten eine Vorstellung hat, die hier Landes bei einem solchen Unternehmen zu bekämpfen sind. Trotz der ausdrücklichen grossherrlichen Erlaubniss, welche er zum Kirchenbaue in Händen hatte, wurde er auf Betreiben seiner türkischen Nachbarn, welche über die grosse Bedeutung dieser Kirche für die ganze Umgegend keineswegs im Dunkeln sind, von den Localbehörden lange Zeit hingehalten, bis er endlich die Geduld verlor, an der Baustelle die grossherrliche Flagge hisste, und unter ihrem Schutze den Grundstein legte. Nun wagten seine Gegner freilich nicht, sich dem Anfänge des Baues mit Gewalt zu widersetzen, dagegen sind sie fortwährend darauf bedacht, dessen Fortgang zu hindern. Kalk, Steine, Sand, Holz, Fahrwege, Alles wird Don Berisch entweder vor Gericht oder mit dem Faustrechte bestritten, und selbst sein Leben wurde mehrmals bedroht. So kam, um nur des letzten Falles zu erwähnen, während unseres Aufenthaltes in Gilan ein Albanese zu uns und ergoss sich mit Thränen in den Augen in Betheuerungen seiner Unschuld, und es dauerte lange, bevor wir uns über das Object dieser Unschuld mit ihm verständigen konnten. Derselbe befand sich nämlich wegen eines Mordanschlages gegen Don Berisch hier in Untersuchung, und wurde beschuldigt, zur Nachtzeit in dessen Hofraum gestiegen zu sein, und auf der Flucht nach der Entdeckung sein Handbeil dort zurückgelassen zu haben. Pis würde leicht sein, diesem Hergange noch eine gute Anzahl anderer Daten anzureihen, aus welchen sich die Erbitterung der türkischen Janjewaner gegen die Christen wegen des Kirchenbaues ergibt. Diese benutzten z. B. unsere Reise, um eine nicht unbedeutende Summe rückständiger Abgaben, wegen deren sie bereits öfters gemahnt worden, nach Gilan zu bringen, weil sich Niemand das Geld dorthin zu schaffen getraute.
Von dieser neuen Kirche stehen bis jetzt erst die vier Grundmauern und der Bau ruht seit einem Jahre wegen Mangel an Fonds.
![]()
138
Die Gemeinde leistete alle Fahr- und Hauddienste umsonst, brach die Steine und schleppte auch schon einiges Holzwerk zum Dachstuhle herbei, die Baarausgaben beschränkten sich daher auf den Taglohn der Kalkbrenner und Maurer. Die letzteren lieferten gegen ihre Gewohnheiten solide, sorgfältige Arbeit, Fenster und Thüren haben steinerne Gesimse, der Plan der Kirche rührt von Don Berisch her; seine Dimensionen sind freilich nach unseren Begriffen keine imposanten, doch den Bedürfnissen der Gemeinde reichlich entsprechend, und wenn die Kirche im Abendlande klein erscheinen würde, so steht sie in ihrer Nachbarschaft doch nur der Klosterkirche von Gratschanitza nach. Daneben wird eine anständige Pfarrwohnung errichtet, in welcher zugleich ein Kaum für die Gemeindeschule bestimmt ist, an deren Spitze ein Skodraner steht, welcher die Kinder serbisch lesen und schreiben und die vier Species lehrt.
Man zeigte uns auch die sogenannte alte Kirche, eine elende stallartige Baracke, welche zu der Kammer führt, in der der Priester wohnte, und öffnete eine Fallthür, welche zu dem Kellerraume führt, in dem noch vor zwanzig Jahren die Messe gelesen werden musste. Ein Blick in dieses Loch und auf den neuen Kirchenbau in der Nachbarschaft des Amselfeldes veranschaulicht den Weg, welchen die auf der Südosthalbinsel angebrochene sociale Krisis bereits zurückgelegt hat, weit drastischer als alle allgemeinen Sätze, und wir bitten den Leser, an diesem Contraste nicht allzuflüchtig vorüberzueilen, wenn er seine Ansicht von dem gegenwärtigen socialen Zustande der europäischen Türkei nicht auf Redensarten, sondern auf Thatsachen stützen will, und dabei zu bedenken, dass man in ihrem ganzen Bereiche bei der Erkundigung nach einem unbekannten Individuum auf die Frage: wer ist er? vorerst die Antwort erhält: er ist ein Christ, Türke, Jude oder Franke, während der Franke die Antwort erwartet: er ist ein Bosniake, Wlache oder Grieche, denn nicht die Nationalität, sondern der Glaube des Unbekannten interessirt den Fragenden in erster Linie, und je nach diesem regulirt er sofort seine Sympathien und Antipathien, seine ganze sociale Stellung zu demselben. Der erwähnte Contrast trifft also nicht etwa auf ein Nebenfeld, sondern auf die Hauptbasis der hiesigen Gesellschaft. Wir wünschen daher dem Werke des wackeren Priesters von ganzem Herzen raschen Fortgang und glückliche Vollendung, weil dasselbe die gesammte sociale Stellung der hiesigen Katholiken nicht nur in ihren eigenen, sondern, auch in den Augen ihrer albanesisch-muhammedanischen Nachbarn heben, und selbst die umwohnenden griechischen Christen aus ihrer Verdumpfung reissen wird.
![]()
139
Auch hat schon die Kirche von Janjewo in nächster Nachbarschaft diese Wirkung gehabt, denn sie weckte die Baulust des eine Stunde bachabwärts gelegenen Dorfes von Unter-Guschteritza, dessen neuen Kirchenbau wir auf dem Hinwege besucht hatten.
Zur Pfarrei von Janjewo gehören vier katholische Häuser in Prischtina und 28 krypto-katholische Familien, das heisst solche, welche im öffentlichen Leben für Muhammedaner gelten, obwohl sie sich im Geheimen zum katholischen Glauben bekennen. Die zweite katholische Pfarrei des Bezirkes von Gilan liegt im Süden von Janjewo auf dem nördlichen Abhänge des Karadag. Der Pfarrort ist das etwa sechs Stunden südlich von Gilan gelegene Dorf Letnitza mit 25 katholischen Häusern. Zu demselben gehören die Dörfer Schaschare mit 40 Häusern, Stubla, etwa eine Stunde südöstlich von Letnitza, mit 20 Häusern, 10 Minuten davon Wernawakolo mit 10 Häusern, und eine Viertelstunde von diesem Wernesa mit sechs Häusern, anderhalb Stunden von Stubla Deps mit einem Hause, und Bintscha, zwei Stunden westlich von Stubla, mit fünf römisch-katholischen und 22 griechisch-katholischen Häusern. Die Zahl der Krypto-Katholiken ist in dieser Pfarrei bedeutender, 17 Familien derselben haben erst vor einigen Monaten ihre katholische Confession vor der türkischen Behörde in Gilan erklärt und sind von derselben anerkannt worden. Die 17 Familien gehören zu dem Geschlechte der 25 Familien, welche im Jahre 1846 bei gleicher Veranlassung sammt ihrem Pfarrer Don Antonio Mariawich aus Lesina nach Brussa geschleppt wurden. Von diesen 184 Köpfe zählenden 25 Familien kehrten nach vierjährigem Exile 75 Personen in ihre Heimath zurück, die übrigen waren den Drangsalen des Exils erlegen. Sie stammten aus den Dörfern Stubla, Bintscha, Wernawakolo und Wernesa. Es ist dies eine herzzerreissende Geschichte, doch wozu verharrschte Wunden aufreissen, nachdem die Zeiten so viel milder und solche Vorfälle unmöglich geworden sind?
Die Gesammtzahl der krypto-katholischen Familien in beiden Pfarreien soll sich auf nicht mehr als 250 belaufen, und die der im Gebiete von Prisrend lebenden wird auf 200, und in dem von Ipek auf 150 beschränkt. Dies ergäbe als Gesammtzahl der albanesischen Krypto-Katholiken des Erzbisthums Skopia [1], dessen Sitz seit Langem nach Prisrend verlegt wurde, die Summe von höchstens
1. Dieses Erzbisthum zählt nach den letzten Angaben nicht 10,000, sondern .0500 Katholiken in 0 Pfarreien, Prisrend, Jakowa, Ipek, Janjewo, Karadag und Zumai. Die Zahl sämmtlicher Katholiken in Nordalbanien und Dardanien wurde im Jahre 1850 auf 96.000 angegeben. S. Alb. Studien I, S. 19.
![]()
140
600 Familien oder 3000 Individuen, und anderwärts giebt es keine Krypto-Katholiken. Freilich spricht man in Skodra von der dreifachen Summe, aber ist denn Skodra der einzige Ort, wo die aus der Ferne zugebrachten Summen auf das Quadrat erhoben werden? Wir vermuthen im Gegentheil, dass selbst unsere Angaben noch überschätzt sind. Doch selbst, wenn sie genau sein sollten, so berechtigen sie dennoch zu der Frage, ob es, ganz abgesehen von dem Rechtspuncte, nicht in dem wohlverstandenen Interesse der Pforte liege, ihre Toleranzedicte auch gegen diese 3000 Seelen in Anwendung zu bringen, indem die ihr aus dem gegen dieselben geübten Glaubenszwang erwachsenden Vortheile in gar keinem Verhältnisse zu dem moralischen Schaden stehen, welchen ihr derselbe in der öffentlichen Meinung von Europa zufügt. Denn welches sind diese Vortheile? einige Recruten; und wie lange kann die ihren christlichen Unterthanen gewährte Militärfreiheit noch dauern? und würden diese 3000 Individuen nach ihrem öffentlichen Bekenntniss zur katholischen Kirche nicht zu Kopf- und Kriegssteuer verpflichtet werden? Bedenkt man nun noch die grossen Verlegenheiten, welche das früher erwähnte Vorgehen gegen die Krypto-Katholiken der Pforte bereitet hat, und die noch grösseren Verwicklungen, welche ihr eine Erneuerung desselben bereiten müsste, so können ihre aufrichtigen Freunde nur wünschen, dass sie ihre Beamten in den betreffenden Bezirken strengstens dazu verhalten möge, den öffentlichen Glaubenserklärungen dieser Krypto-Katholiken keine Hindernisse in den Weg zu legen. Doch haben, wie gesagt, die Behörden von Gilan bereits einen lobenswerthen Anfang in diesem Sinne gemacht; hoffen wir, dass auch die übrigen Bezirksobrigkeiten diesem Beispiele folgen werden.
Janjewo scheint das Ueberbleibsel einer alten grösseren Stadt zu sein, vielleicht war sie das Centrum der in ihrer westlichen Nachbarschaft betriebenen Bergwerke, von denen wir Spuren auf unserem Wege von Janjewo nach Gilan sahen, und hierauf dürfte auch die städtische Metallindustrie des Ortes hindeuten. Auch sind auf den beiden Abfällen der Schluchtwände in die Ebene die Reste zweier fester Schlösser vorhanden, welche die Schlucht, in der Janjewo liegt, gegen die Ebene absperrten. Dagegen sollen die bei der sogenannten alten Kirche von Janjewo liegenden Steine [1] von den eine Stunde südlich von Janjewo gelegenen Resten einer alten Stadt herrühren. Die Stelle, an welcher diese stehen, wird Basiowitsch genannt,
1. Der Anhang der ersten Auflage enthält deren Inschriften.
![]()
141
und liegt an der Kosnitza Rjeka. Von diesen Ruinen wurden auch viele Steine mit Inschriften zu dem Bau der sogenannten Mühlen des Pascha verwandt, welche an der Sutefska Rjeka, einem Nebenbache der Grätschanitza, liegen. Diese Ruinen sind vielleicht die Reste der alten Stadt Kossowa, welche der Ebene den Namen gegeben hat, denn Hadschi Khalfa, S. 144, bezeichnet deren Stelle zutreffend, indem er sagt: wenn man von Katschanik nach Jannowa geht, so liegt diese Stadt ohne Mauern am Rande des Thales, d. h. wohl der Ebene, die er unmittelbar vorher als eine längliche Fläche, auf beiden Seiten von Bergen umgeben, beschrieben hat. Er fügt bei : „die Einwohner sind meistens Bergleute“ und dass die Gerichtsbarkeit Kossowa sonst auch Palaschina heisse. Bei Prischtina heisst es ferner: „da Kossowa in diese Gegend fällt, so wohnt hier (in Prischtina) der Aufseher der Minen“ und bei Jannowa, dass es in der Gerichtsbarkeit von Kossowa liege. Später aber scheint die Gerichtsbarkeit von dieser Stadt Kossowa auf Janjewo übergegangen zu sein, denn bei Hammer [1] findet sich folgende Stelle: „Einrichtung der Martolos’ [2] des Districtes Bana; diese Grenzwachen sind mit einem Scheffelgelde von vier Aspern vom Scheffel Landes (dönüm) eingeschrieben, wie die Gärten der Moslimen in den Gerichtsbarkeiten von Nowabarda und Janowa.
XXI. Gilan.
Am folgenden Morgen fühlte sich der Verfasser nicht im Stande, ein Pferd zu besteigen, und musste daher den Fahrweg nach Gilan einschlagen, während Major Zach und Herr Gottschild zu Pferde nach Nowo Brdo gingen. Dieser Fahrweg führt längs der südlich von dem Janjewobache und parallel mit demselben von Osten nach Westen fliessenden Kosnitza Rjeka bis zu dem Quellgebiete eines in derselben Richtung fliessenden Nebenbaches, längs welches er durch enge, mit Eichen und Buchen bestandene Waldthäler zur Wasserscheide aufsteigt. In diesen stiessen wir auf mehrere mit alten Schlacken bedeckte Strecken, in deren Nähe zahlreiche alte Schachte und Stollen sein sollen.
Die Wasserscheide wird da, wo sie der Weg kreuzt, von einem langgestreckten, von Norden nach Süden laufenden und Horma genannten Rücken gebildet,
1. Des osmanischen Reiches Staatsverfassung I, S. 321.
2. Martolos ist offenbar eine Verstümmlung aus Armatolas; die nördliche Ausdehnung dieses Namens bis zur serbisch-bosnischen Grenze ist sehr beachtenswerth.
![]()
142
deren Kamm uns nicht viel niedriger als der nord-ost-nördlich davon liegende und von der Festung Nowo Brdo gekrönte Kegel zu sein schien, welchen wir einmal durch einen Kiss in dem alle Höhen bedeckenden Nebelvorhange erblickten.
Von der Wasserscheide senkt sich der Weg auf einem zwischen zwei zur Morawa gehörenden Bächen sanft abfallenden Vorstoss des Hormarückens in östlicher Richtung in den Kessel von Gilan. Etwa eine halbe Stunde südlich von dieser Neige zeigt sich das Dorf Ponesch auf einem Vorsprunge des Rückens, dessen Bewohner bis zur Einführung der Refonnen das Privilegium gänzlicher Abgabenfreiheit genossen, welches sich gleich dem von Babusch auf dem Amselfelde von der Zeit der Schlacht von Kossowo datirt ; es soll der Sage nach von Sultan Murad für ein schönes Mädchen ertheilt worden sein, welches die Poneschaner in seinen Harem lieferten.
Der Kessel von Gilan bietet keine Ebene, sondern mehrere mit verschiedenen Erhebungen besetzte Sohlen, deren grösste, von Osten nach Westen laufend, denselben, wenn wir richtig gesehen, vorzugsweise in zwei Längenhälften spaltet; in der nördlichen liegt Gilan, in der südlichen fliesst die Morawa, etwa eine Stunde südlich von der Stadt. Dieser Fluss longirt in der Richtung von Westen nach Osten den nördlichen Abfall des Karadag und tritt dann in sein erstes zwischen Gilan und Wranja gelegenes Défilé.
Der Kessel von Gilan ist jedoch nur die untere Hälfte des ebenen Quellgebietes der Morawa, indem die südliche, sich allmälig senkende Fortsetzung des Hormariickens die obere westliche Hälfte von derselben trennt, jedoch sich mit ihrem Südabfall so weit vom Karadag entfernt hält, um ein kleines, etwa zwanzig Minuten breites Thal übrig zu lassen, in welchem die Morawa fliesst.
Der Grund, warum sich in die herkömmliche Orthographie des Namens Gilan ein h eingeschoben hat, ist uns nicht klar, wenn es nicht das anlautende Gaumen-g bezeichnen soll; in der zweiten Sylbe dagegen konnten wir weder bei Slaven noch bei Albanesen eine Spur davon entdecken, denn beide sprechen einfach Gilan, doch erfuhr Major Zach, dass die Bauern es auch Gnilan nennen, was, wenn es kein Calembourg ist, die Bedeutung Kothheim gäbe, und diese könnte nicht zutreffender sein, denn bei einem Ritte durch die Stadt wateten die Pferde oft bis an die Knie in dem schwarzen Sumpfe, welcher hier die Stelle des Pflasters vertritt, und wenigstens den Vortheil gewährt, dass er dem Reisenden die günstigste Idee von der ausserordentlichen Fruchtbarkeit des Bodens aufzwingt, auf dem Gilan liegt. Trotz dieses Uebelstandes und des trüben Regenhimmels
![]()
143
machte die kleine Stadt keinen unfreundlichen Eindruck, indem sie wesentlich aus einer geraden Strasse besteht, welche wenigstens viermal so breit ist, als die behäbigen kleinen Häuser hoch sind, die sich locker zu beiden Seiten an einander reihen. Der Mudir, ein wackerer Albanese aus Unter-Dibra, hatte unter denselben das kaum vollendete schmucke Häuschen eines jungen wlachischen Krämers ausgesucht, in welchem wir uns sehr gemüthlich fühlten.
Die ganze Stadt machte auf uns einen modernen Eindruck, und unsere Erkundigungen über ihr Alter zeigten, dass wir uns hierin nicht getäuscht hatten, denn diesen zu Folge ist Gilan nicht älter als etwa vierzig Jahre, und wurde von einem der erblichen Dynasten dieser Landschaft, Reschid Bey, gegründet, der Allen, welche sich in der jungen Stadt niederliessen, Unterstützung bei dem Baue der Häuser und völlige Steuerfreiheit gewährte, und überhaupt wegen seiner gerechten und patriarchalischen Regierung, im Gegensätze zu seinem die Christen hassenden und quälenden Nachfolger, bei den Gilanern in sehr gutem Andenken stellt. Seine Familie stammte aus dem in der Nachbarschaft von Prisrend gelegenen Dorfe Dschinitsch, und war vor etwa hundert Jahren nach Nowo Brdo übergesiedelt, wo sie sich alsbald an die Spitze schwang.
Obgleich albanesischer Abstammung, lebte sie doch mit den Albanesen des nahen Golak in beständigen Fehden, bei welchen ihre am Fusse der Akropole von Nowo Brdo gelegene Residenz dreimal in Rauch aufging. Vielleicht war dies der Grund, welcher Reschid Bey bewog, dieselbe in eine friedlichere Gegend zu verlegen, und er wählte zu dem Ende den Punct des beschriebenen Kessels, welcher die grösste Fläche darbot, und wo sich zwei kleine Bäche zu einem grösseren Bache vereinigen, welcher von da in südlicher Richtung der Morawa zufliesst. Hierher stellte er seine neue Residenz, ein mächtiges, mit vielem Luxus ausgestattetes Gebäude [1] in orientalischem Style, welches jetzt in Trümmer zerfällt, denn seine Nachfolger hatten dasselbe Schicksal, welches alle erblichen Dynasten der Südhalbinsel betroffen hat. Sie betheiligten sich bei den verschiedenen Bewegungen der türkischen Landaristokratie gegen die neue Ordnung der Dinge und verloren nicht nur ihre Herrschaft, sondern auch den grössten Theil ihres Privatvermögens. Die einzelnen Familienglieder kamen dabei um, oder starben im Elend ;
1. Eine detaillirte Beschreibung desselben liefert Pouqueville’s Bruder, Voyage de la Grèce III, S. 166.
![]()
144
doch ist ein überlebender Sprössling in grossherrlichen Diensten, und wenn wir uns recht erinnern, Gouverneur in einem asiatischen Paschalik.
Ganz denselben Verlauf nahm auch die Geschichte der Dynastenfamilie von Skopia, welche noch Griesebach [1] in ihrem Glanze sah, und deren Paläste in jener Stadt und in Kalkandele verfallen, während der jetzt lebende Sprössling gleichfalls fern von der Heimath dem Grossherrn dient. Wir kennen auch im alten Albanien nur eine Familie, welche sich durch ihre während aller inneren Stürme der Pforte erwiesenen Treue in der von den Vätern überkommenen Regierung ihrer heimathlichen Landschaft erhalten hat. Es ist die der Bey’s von Tyranna, deren Residenz etwa sechs Stunden nordöstlich von Durazzo liegt. Vielleicht trifft sich in andern Gegenden der Südosthalbinsel noch eine oder die andere ähnliche Erscheinung, aber solche schwache Nachklänge vergangener Zeiten bestätigen nur als Ausnahme von der Regel den Untergang des Elementes, zu dem sie gehören. Die Kämpfe, in die sich die türkische Landaristokratie gegen die neue Ordnung der Dinge einliess, welche Sultan Mahmud einzuführen begann, endeten mit ihrem unwiderbringlichen Untergange.
Sie zerfiel bekanntlich in zwei Classen, in den Lehensadel oder die sogenannten Spahis, welche statt des Soldes mit der Grundsteuererhebung von gewissen Gründen belehnt waren, und in die Dynasten, welche bestrebt waren, sich in den ihnen von der Pforte verliehenen Verwaltungsämtern möglichst unabhängig und dieselben in ihren Familien erblich zu machen. Sobald es einem Pascha oder unteren Verwaltungsbeamten gelungen war, begann er in der Regel seine Kräfte gegen den türkischen Provinzialadel zu richten, und wenn er es vermochte, rottete er denselben aus, wie dies z. B. dem bekannten Ali Pascha von Tepelen in Epirus und den Erbpascha's von Skodra im nördlichen Albanien gelang, welche in dem Verfahren, das sie zu diesem Zwecke einhielten, eben so treu die Vorschriften von Macchiavell’s Principe befolgten, wie Ali, bei ihrem Treibenaber von keinem Pouqueville beobachtet wurden. Ja man kann sagen, dass Ali und die Buschatli’s Albanien der Pforte erst erobert haben, dessen frühere Zustände kaum in den blühendsten Perioden unseres Faustrechtes eine Parallele finden dürften.
Da ich mich bei meiner Ankunft in Gilan wohler fühlte, so war ich gleich darauf bedacht, möglichst viel chorographische und statistische Erkundigungen einzuziehen. In dieser Beschäftigung traf
1. S. Reise durch Rumelien, II, S. 230.
![]()
145
mich der Rath des Bezirkes (Medschlis), der mich am folgenden Morgen besuchte, und zwar gerade in dem Momente, als mir die erste Notiz von einem bis dahin unbekannten Flusse, der Kriwa Rjeka, gegeben wurde. Voll von diesem Gegenstände beging ich gegen diese respectable Körperschaft einen der grössten Verstösse gegen die Convenienz, welcher nach türkischer Anschauung möglich ist, denn kaum hatte man Platz genommen und waren die nothwendigsten Temena's gewechselt, bei welchen die Grüssenden mit den Fingerspitzen der rechten Hand den eigenen M- und und die Stirne berühren, so richtete ich in der Zerstreuung an .den mir zunächst Sitzenden die Frage: ob er wisse, wo die Kriwa Rjeka entspringe; und hier zeigte sich der türkische Anstand in seiner Vollendung, denn wenn der Gefragte nur durch irgend ein Zwinkern des Auges seine Ueberraschung über diese extravagante Frage verrathen hätte, so musste mich dies aus meiner Zerstreuung reissen, weil wir bei der Enge des Raumes sehr nahe an einander sassen, doch der Mann antwortete so ruhig und natürlich, als ob er nur in dieser Absicht zu mir gekommen wäre; ich notirte also seine Angabe und fragte weiter. So war ich in meinem Examen bereits ein gutes Theil von der Quelle bachabwärts gekommen, als der Kaffee und die Pfeifen erschienen und mich an den begangenen Verstoss mahnten; denn bevor der Kaffee genommen ist, bleibt jede ernstere Frage von dem Gespräche ausgeschlossen, und erst nach diesem Acte beginnt man sich, jedoch nur auf einer sich stets verengenden Spirallinie, der Frage zu nähern, welche den Gegenstand der Zusammenkunft ausmacht, denn nichts ist dem Türken anstössiger, als wenn man ihm nach unserem Sprichworte mit der Thür ins Haus fällt.
Aber nun war es zu spät, ich fuhr also in meinem Examen fort, und als die Herren endlich aufbrachen, um sich zu ihrer Sitzung zu verfügen, bat ich meinen Nachbarn, nach derselben wiederzukommen, was er mit derselben natürlichen Freundlichkeit zusagte, die er während des Examens niemals verläugnete. Es war dies ein äusserst intelligenter Vierziger, Namens Maxut Eftendi, der Cassenbeamte des Bezirkes, ein geborner Gilaner, der, wie er höflich behauptete, sich durch das Interesse, welches ich seiner Heimath sckenke, sehr geschmeichelt fühlte.
Am Nachmittage traf der Major von seinem Ausfluge nach Nowo Brdo ein und Maxut Eftendi’s Instructionen bereiteten milden Triumph, dessen Anzeige von einem neu entdeckten Flusse mit der Frage erwidern zu können: „heisst er nicht Kriwa Rjeka? und entspringt er nicht da und da?“ u. s. w. Nachdem der Major sich
![]()
146
von seiner Ueberraschung erholt hatte, vindicirte er wenigstens die Priorität der Entdeckung, da er die Kriwa bereits Tags zuvor mit eigenen Augen gesehen, während ich erst heute Morgen ihre Bekanntschaft vom Hörensagen gemacht habe, und nach langem Discutiren und vielem Lachen verglichen wir uns dahin, dass er mir die Mündung des Baches in die Morawa abtrat, über welche ich genauer unterrichtet war als er.
Der Major schilderte Nowo Brdo als eine auf einem hohen Berge gelegene mittelalterliche Festung, deren schon baufällige Umfassungsmauern ein Réduit mit flankirenden Thürmen umschliessen. Das Städtchen liegt auf der nordöstlichen Seite des Berges und besteht nur noch aus fünfzehn türkischen und einem christlichen Hause, sie haben sehr massive Mauern, deren Steine von dem verfallenen Schlosse genommen sind. Die türkischen Einwohner sagen, dass sie Osmanli seien, und der Name ihres Stammes Emir deutet darauf hin, dass sie sich zu den Abkömmlingen des Propheten rechnen. Auch scheinen sie mit ihren albanesischen Nachbarn nicht in dem besten Einvernehmen zu stehen. Sie behaupten, dass Nowo Brdo früher eine sehr bedeutende Stadt gewesen sei und 6000 Häuser gezählt habe, die Christen verdoppeln sogar ihre Anzahl. So wenig auch dergleichen Zahlenangaben, besonders wenn sie der Vergangenheit angehören, Glauben verdienen, so wird doch die frühere Blüthe dieser Stadt auch von den osmanischen Geschichtschreibern und Geographen [1] mit dem Zusatze bestätigt, dass Nowo Brdo wegen seiner reichen Silberminen den Beinamen „Mutter der Städte“ führe, welchen wir lieber auf das hohe Alter derselben beziehen möchten. Sie verdankte diese Blüthe wohl ausschliesslich den bedeutenden Silberbergwerken ihrer Nachbarschaft, welche jedoch jetzt vollkommen und vermuthlich seit geraumer Zeit eingegangen sind, weil weder in Janjewo noch in Nowo Brdo dieser Zeitpunct auch nur annäherungsweise bestimmt werden konnte; denn seitab von allen Verbindungslinien gelegen, hat seine Lage weder commercielle, noch strategische Bedeutung, und daher erklärt sich der Verfall des Ortes nach dem
1. Hadschi Khalfa Rumeli und Bosna S. 145 sagt z. B. : „Hier finden sich die meisten Pachtungen der Mineninspection von Uskub. Dieser Ort ward zuerst im Jahre 841 den Ungläubigen entrissen ; als dann im Jahre 859 der Despot, der hier herrschte, gestorben war, sendete Mahomed der Eroberer den Isakhegs, Islabeg, der das Schloss zum zweiten Male mit allen Schätzen eroberte“ ; und bei Janowa heisst es, dass diese Stadt zwischen Prischtina und Nowo Brdo liege, „letzteres hat Silberminen“.
![]()
147
Eingehen der Bergwerke sehr natürlich. Die meisten Einwohner sollen von hier nach Prischtina und später nach Gilan übergesiedelt sein.
Die alte Stadt reichte vermuthlich bis zu dem südlichen Fusse des Berges, wo bei dem heutigen von Bulgaren bewohnten Dorfe Bostan (Gartenfeld) die Ruinen einer Kirche und eines grossen Palastes liegen, welcher die oben erwähnte frühere Residenz der Dynasten von Nowo Brdo war, bevor sie nach Gilan zogen.
Wir blieben noch einen Tag in Gilan, benutzten aber das heitere Wetter des folgenden, um über das sumpfige Quellbecken der Morawa nach Katschanik zurückzukehren. Dieser Tagmarsch wurde durch die Umwege, zu denen die bereits ausgetretenen Sümpfe nöthigten, zu dem stärksten der ganzen Reise, denn obgleich wir bereits vor 6 Uhr Morgens nach Gilan abgingen und uns unterwegs kaum eine Stunde Rast gönnten, so kamen wir doch erst gegen 9 Uhr in Katschanik an, mussten also fast drei Stunden in der Nacht fahren. Zum Glück war der Himmel sternhell und kamen wir daher ohne Unfall an. Doch hatte uns Gusman, der Kutscher des Majors, gegen Abend keinen kleinen Schreck verursacht, indem er beim Uebergange über die Wasserscheide an einer abschüssigen Stelle auf einen Baumstumpf fuhr und umwarf. Beide Pferde stürzten und das Ganze gewährte ein haarsträubendes Bild. Doch der Stern, der unsere Reise begleitete, blieb uns treu ; Menschen und Pferde, Wagen und Bagage waren unverletzt, und nach viertelstündigem Aufenthalte zogen wir weiter. Die moralische Wirkung des Vorfalls tönte jedoch lange nach, denn Jowan gewann hierdurch Oberwasser über Gusman, und dieser enthielt sich von da an jeder Anspielung auf den Deichselbruch vor dem Kloster von Gratschanitza, womit er früher gegen Jowan sehr freigiebig war. Wir bewunderten bei jener Gelegenheit die Gewandtheit dieser beiden Leute; kaum war der Schaden constatirt, so waren auch schon nach der Angabe des Majors die Eichenstäbe geschnitten, dieselben als Schienen an die zwei Deichselstücke angepasst und mit Stricken festgeschnürt, und in einer Viertelstunde fuhren wir mit dieser Nothdeiehsel weiter, welche sich so tüchtig bewährte, dass wir in Prischtina darauf dringen mussten, dass die Eichenstäbe durch eiserne Bänder ersetzt wurden.
Trotz des kothigen Weges rechnen wir die Fahrt durch das Quellbecken der Morawa zu den angenehmsten unserer Reisen, weil sie uns einestheils eine Gegend von ausserordentlicher Fruchtbarkeit und die ungeahnte Dichtigkeit ihrer behäbigen Bevölkerung zeigte, und sich anderntheils das Auge an dem herrlichen Anblicke der
![]()
148
Ljubatrn-Pyramide eifreute, als gegen Mittag der Nebel von ihr wich und sie in ihrem fleckenlosen Wintergewande in den klaren Abendhimmel hineinragte. Der Gegensatz der dunkelgrauen, scharfkantigen Felsrücken des Karadag erhöhte den Reiz des Bildes. Wir hatten dieses letztere Gebirge nun fast gänzlich umkreist und namentlich an jenem Tage seine höchste Partie näher zu betrachten Gelegenheit, und darum dürften hier einige Worte über dasselbe am Platze sein.
Wie wir bereits in der Einleitung zu diesen Blättern zu erwähnen Gelegenheit hatten, zieht sich durch den Rumpf der Südosthalbinsel ein ebener, meist durch breite Thäler oder Ebenen laufender Spalt längs der Flüsse Morawa und Wardar, welcher sich im grossen Ganzen als eine Grenzscheide der Bodenbildung dieser Halbinsel betrachten lässt, denn in ihrer westlichen Hälfte ziehen die Gebirge mit wenigen Ausnahmen von Norden nach Süden, oder von Nordwesten nach Südosten, während der Osten der Halbinsel in dieser Hinsicht mehr Abwechslung zeigt, wenn auch in dem nördlichen Theile durch den Zug des Balkan die Richtung von Westen nach Osten vorherrscht.
Eine Ausnahme von deir in dem Westen herrschenden Regel bildet jedoch die nördliche Hälfte der alpinen Kette des Schar, denn sie läuft von Westsüdwresten nach Ostnordosten und endet in dieser Richtung mit dem Ljubatrn (während seine südliche Hälfte von Norden nach Süden streicht). Bedenkt man nun, dass die östlich davon gelegene sogenannte Kurbetzka Planina dieselbe Richtung verfolgt, so liegt die Vermuthung nahe, dass der zwischen beiden gelegene Karadag ebenfalls von Westen nach Osten streiche und ein Glied jener westöstlichen Centralkette der Halbinsel bilde. Dies ist jedoch nach unseren Beobachtungen, wenigstens bei der nördlichen Hälfte des Karadag nicht der Fall, denn die die Südwand des Quellbeckens der Morawa bildenden Berge bestehen aus sechs, parallel von Südosten nach Nordwesten streichenden Ausläufern. Es sind steil aufsteigende, fast wandartige Felszüge mit scharfen, kantigen Kämmen. Sie scheinen zwar eine westöstliche Querverbindung zu haben und diese kettenartig aufsteigend in dem auf der Kiepertschen Karte verzeichneten, jedoch wohl etwas zu weit nordwestlich angesetzten Gipfel zu culminiren. Die Formation des nördlichen Abfalles scheint uns jedoch zu prononcirt, um nicht zu vermuthen, dass ihm nicht der südliche correspondiren sollte, und hierauf deutet wohl der Lauf des Lipkowkabaches, längs welchem der Weg von Kumanowa nach Gilan führt, sehr bestimmt hin, denn dieser
![]()
149
fliesst von Nordwesten nach Südosten, und die zahlreichen Nebenbäche, welche der Karadag in den Lepenatz und den Wardar herabschickt, lassen darauf schliessen, dass sie aus den Querfalten der Westseite des Karadag kommen und dessen Hauptkette zwischen Lepenatz und Lipkowka von Nordwesten nach Sudosten streicht und daher diese Flusse in Längsthälern diessen. Zu demselben Schlüsse berechtigt wohl die Vergleichung des Laufes der Lipkowka und Golema mit dem der Kriwa und Perlepnitza in Bezug auf die Richtung der zwischen ihnen liegenden Bergzüge, denn sie laufen sämmtlich von Nord westen nach Südosten, und es scheint demnach, dass die Morawa in ihrem ersten Défilé zwischen Gilan und Wranja Höhenzüge zu durchbrechen hatte, welche in dieser Richtung laufen. Was endlich am meisten für unsere Annahme zu sprechen scheint, ist der Mangel jedes Thales in dem Südabfalle des Karadag gegen die Mustapha Owassi zwischen der Lipkowka und dem Wardar, also auf einer Strecke von etwa sechs Stunden, denn er zeigt, dass sämmtliche Wasser dieses Gebirgstheiles durch westöstliche Querthäler in den Wardar oder die Lipkowka abgeführt werden müssen. Wir glauben aus diesen Beobachtungen folgern zu dürfen, dass der Karadag aus zwei von Nordwesten nach Südosten laufenden Ketten bestehe, welche die Thalwände der zwischen ihnen laufenden Lipkowka bilden, im Norden aber eine Querverbindung haben dürften. Von diesen Ketten ist die westliche die bedeutendere und culminirt im Norden kurz vor ihrem Abfall gegen die Fläche des Amselfeldes und des Morawa-Quellbeckens. Kiepert giebt nach Boué und Viquesnel ihren Gipfel auf 2400 Fuss Meereshöhe an; wenn wir jedoch bedenken, wie mächtig derselbe die über 1400 Fuss hohe Ebene [1] des Quellbeckens der Morawa überragt, so möchten wir diese Schätzung wenigstens um ein Drittel erhöhen. Wir sahen diesen Gipfel von dem neun bis zehn Stunden westlich gelegenen Rujan als die weitaus höchste Spitze des ganzen Karadag. Da wir uns vergebens nach dem Namen dieser Spitze erkundigten, und man uns stets mit dem Namen Karadag antwortete, so ist dies vielleicht der ,schwarze Berg“ im engeren Sinne, und wurde der Name von ihm auf die zu ihm gehörige Gebirgslandschaft ausgedehnt. Seine obige Beschreibung zeigt, dass er seinen Namen mit Recht führt, denn er besteht aus einer Masse von nackten Felsketten, in deren Spalten wohl auch kein fetter Humus lagern kann.
1. Klokot 1478 P. F. Meereshöhe.
![]()
150
Auffallend war für uns die Aehnlichkeit des nördlichen Karadag mit den über einander aufsteigenden Felswänden, welche wir auf dem Kolnik als Parallelketten des Schar in der Richtung von Norden nach Süden streichend erblickten, so dass sich uns unwillkürlich die Frage aufwarf, ob sie nicht derselben Periode angehören könnten. Der Hinblick auf dieselben führt jedenfalls zu dem topographischen Ergebnisse, dass die Nordhälfte des Schar mit ihrer westöstlichen Richtung trotz ihrer alpinen Verhältnisse sich als eine Ausnahme der allgemeinen Bodenbildung ihrer Nachbarschaft ergibt und daher keinerlei Wirkung auf dieselbe äussert, denn in ihrem Süden folgen die oben erwähnten Karschiakketten der regelmässigen Richtung, in nächster östlicher Nachbarschaft verrennt der Karadag dem Ljubatrn gleichsam den Weg, im Norden dieser letzteren folgen die Höhenzüge der Drenitza abermals der Regel, ihnen östlich gegenüber endlich läuft der Kosnik und Horma Planina von Nordwesten nach Südosten, und scheint dies auch die Richtung der drei Felsberge nördlich vom Nowo Brdo zu sein, welche sich hoch und einsam über die sie umgebenden Hügellande erheben.
Nach dem Blicke vom Rujan aus und nach seinen östlichen und südlichen Ausläufern zu urtheilen, dürfte der ganze Karadag mit Ausnahme seines nordwestlichen Culminationspunktes eher den Namen eines Hügelals den eines Gebirgslandes verdienen, denn von den erwähnten Ausläufern, welche wir im Morawitzathale und dem Nordrande der Mustapha Owassi longirten, dürfte keiner die Höhe von 500 Fuss über der Ebene erreichen, und daher erscheint Kiepert's Darstellung des südlichen Theils dieses Gebirges als viel zu schwarz gerathen.
Der Karadag zeigt sich als ein nach allen Seiten hin abgeschlossenes Ganze und steht mit andern Bergen nur an einem Punkte in Verbindung, nämlich im Nordwesten durch den die Wasserscheide zwischen Morawa und Sitnitza bildenden niedern Höhenbuckel mit den Ausläufern, welche der Hormarücken gegen Westen schickt, denn gegen Norden wird er durch das Rinnsal der Morawa, im Osten durch das der Morawitza und Golema, im Westen durch die Neredimka, Lepenatz und Wardar abgegrenzt, und im Süden fällt er ziemlich steil und gleichmässig gegen die Mustapha Owassi ab. Doch mögen in der Urzeit da, wo sich die Morawa und der Lepenatz gewaltsam durch ihn Bahn gebrochen haben, weitere Verbindungen mit den Nachbarbergen bestanden haben.
Wir fürchten den Leser zu sehr zu ermüden, wenn wir ihm μ ach diesen orographischen Auslassungen noch zumuthen wollten
![]()
151
mit uns durch die einzelnen Dörfer des Quellgebietes der Morawa zu ziehen und über jeden einzelnen seiner Bäche zu setzen. Wir ziehen es daher vor, den Liebhaber solcher Details an den topographischen Theil der ersten Ausgabe zu verweisen, wo er dergleichen zur Genüge finden wird, und schliessen mit der Bemerkung, dass die in den beiden westlichsten der oben beschriebenen Felsspalten des Karadag entspringenden Bäche Binatsch und Butschiwo sich kurz vor ihrem Eintritte in die Ebene vereinigen, und der Bach von da an Morawa genannt wird. Dieser beschreibt bei seinem Eintritte in die Ebene, sich gegen Osten wendend, mit seinem früheren Laufe einen spitzen Winkel und erhält, durch eine sumpfige Niederung seinem ersten Défilé zufliessend, zahlreiche Zuflüsse aus Norden und Süden.
Von Katschanik kehrten wir bei leidlichem Wetter auf der durch das Lepenatzdéfilé führenden Kunststrasse nach Skopia zurück, doch schien der Kegen nur auf unsere dortige Ankunft gewartet zu haben, denn er überfiel uns beim Auspacken und verwandelte sich bald darauf in Schnee. Am folgenden Morgen zeigte sich uns Skopia im Winterkleide und behielt es die Woche über, welche wir dort an dem Kamine unserer gemüthlichen Wohnung mit Kartenzeichnen, Einholung der Rückstände und neuen Erhebungen, namentlich über das Treskagebiet rasch verbrachten, da der Besuch dieses letzteren durch den Winter vereitelt war. Dieser zeigte sich am Ende der Woche strenger als am Anfänge; wir verzweifelten also an einer raschen Aenderung des Wetters, und beschlossen trotz Schnee und Kälte gegen Süden aufzubrechen, doch nicht, ohne uns vorher gegen deren Einwirkung möglichst verwahrt zu haben.
Bevor wir jedoch der Morawa und ihrem Gebiete den Rücken kehren, wollen wir noch einen Blick auf die Niveauverhältnisse von Dardanien und seiner Nachbarschaft werfen.
XXII. Ueber das Niveau von Dardanien.
Das Ländergebiet im Süden von Serbien entbehrt bis jetzt eines Gesammtnamens. Da aber die Wissenschaft eines solchen nicht wohl entrathen kann, so möchten wir dafür den alten Namen Dardanien [1] vorschlagen und denselben etwa bis zur nördlichen
1. Nähere Untersuchungen über dessen alte Grenzen finden sich in der dritten Abtheilung dieser Arbeit.
![]()
152
Wasserscheide der Czerna (Erigon) und der südlichen Wasserscheide der Bregalnitza erstrecken, dies Gebiet aber durch die über die Kurbetzka, den Karadak und die nördliche Hälfte des Schars laufende Wasserscheide zwischen Donau und Wardar in Nord- und Süd-Dardanien [1] trennen. Das südliche Nachbargebiet wäre dann Macedonien und östlich würden beide Gebiete durch die Wasserscheide des Strymon von Thracien und westlich durch die Ketten des Schar Peristeri und Pindus von Albanien geschieden.
Vom Donaustrome südwärts vorrückend, würden sich hiernach die verschiedenen Ländergebiete folgendermassen aneinanderreihen : Serbien, Dardanien, Macedonien und Thessalien.
Die serbische Morawa läuft der Save und Donau parallel von Westen nach Osten und zeigt mithin, dass das südliche Serbien sich in dieser Richtung senkt, während die Senkung des nördlichen in Uebereinstimmung mit dem Laufe der Drina und der vereinten Morawa von Süden nach Norden streicht.
Die Meereshöhe des Rinnsals der serbischen Morawa beträgt im Westen bei Tschatschak zwischen 500 bis 600 Fuss; im Osten bei Stalatsch, ihrem Ende, zwischen 300 und 400 Fuss. Dass nun das am südlichen Fusse der Lepenatz- und Jastrebatzkette anlagernde dardanische Flachland sich in derselben Richtung senkt, zeigt der westöstliche Lauf der Toplitza und der Pusta Rjeka; doch liegt dieses Flachland bedeutend höher als das Rinnsal der serbischen Morawa. denn nach unseren Messungen beträgt die Meereshöhe von Kurschumlje 1033, die Tularemündung in die Toplitza 829, Prokop 625 und die Mündung der Toplitza in die bulgarische Morawa bei Kurwingrad 555 Fuss.
Auch die Jablanitza und die Weternitza zeigen bei ihrem Eintritte in die Ebene die gleiche Neigung, und ihre Rinnsale scheinen nur unbedeutend höher zu liegen als das der Toplitza, denn unsere Messungen ergaben für die Vereinigung des Tulare- und Banskabaches zur Jablanitza 1105, für die Mündung der Guribaba in dieselbe 746 und für Leskowatz 590 Fuss.
Endlich folgt der obere Lauf der bulgarischen Morawa, ungeachtet der dazwischen liegenden Gebirgslandschaft, derselben Richtung von Westen nach Osten, doch bei bedeutend höherem Niveau, denn Klokot im Quellbecken des Flusses ergab 1478 Fuss,
1. Für Süd-Dardarnien den schon in der späteren römischen Kaiserzeit verschwundenen Namen von Päonien zu setzen, scheint uns auch wegen seiner unsicheren Grenzen nicht rathsam. Bei Livius XLV reclamiren die Dardanen Päonien als ihnen gehörig. S. unter Abtheil. III, Abschnitt IV.
![]()
153
und den Morawaspiegel bei Wranja (1279 Fuss) möchten wir wenigstens auf 1000 Fuss schätzen.
Diese drei Landstriche bilden mithin ganz unabhängig von den in ihnen streichenden Gebirgen drei von Norden nach Süden ansteigende Staffeln, welche sich gleichmässig von Westen nach Osten einer durch die ganze Breite der Halbinsel streichenden nordsüdlichen Spalte zusenken. Diese Spaltung zerfällt in Bezug auf ihre Senkung in zwei Hälften. Die grössere, nördliche (Morawa-Rinne) senkt sich etwa 80 Stunden lang von Süden nach Norden, die kleinere, südliche (Wardar-Rinne) senkt sich etwa 60 Stunden lang von Norden nach Süden.
Das zur Südhälfte dieser Spalte gehörige Flachland der Mustapha Owassi, dessen vermuthliche Mittelhöhe zwischen 700 bis· 800 Fuss beträgt, wird von dem oberen Morawathale, der höchsten Südstaffel der nördlichen Spalte, durch den Karadag und die westlichen Ausläufer der Kurbetzka getrennt und ist mit demselben nur durch die zwischen diesen Gebirgen streichende Einsattlung verbunden, in der die Morawitza- und Golemabäche fliessen, steht aber in Bezug auf seine Senkung im directen Gegensätze zu den dardanischen Flachlanden, denn der Lauf der sie durchschneidenden Wasser von Egripalanka (Ptschinja) und der Bregalnitza zeigt, dass sie von Osten nach Westen dem Wardar zustreicht.
Die Frage, ob die dardanischen Flachlande mit dem Amselfelde ein Ganzes bilden, und dieses als deren Culminationspunct betrachtet werden kann, müssen wir weiterer Forschung überlassen. Unsere Vermuthung hierüber haben wir in der Rundsicht von dem Rujan ausgesprochen. Wir können dieselbe nur in Bezug auf das Quellbecken der Morawa bejahen, weil deren vom Karadag auslaufende Wasserscheide aus einer niedrigen Höhenbühle besteht, und das Niveau beider Flächen so ziemlich gleich ist, denn die vermuthliche Mittelhöhe des Amselfeldes beträgt 1500 Fuss, und Klokot, in der Mitte des Quellbeckens der Morawa gelegen, ergab 1478 Fuss.
Wir möchten das Amselfeld im weiteren Sinne bis zum nördlichen Fusse des Ljubatrn ausdehnen, ihm das Gebiet der Neredimka wegen der oben besprochenen Bifurcation dieses Baches zuweisen, und demnach eine doppelte Senkung in entgegengesetzter Richtung zuerkennen, eine kürzere von Norden nach Süden (Neredimka) und Nordwesten nach Südosten (Lepenatz) und eine längere von Süden nach Norden und Nordwesten (Sitnitza), welcher sich in ihrer nördlichen
![]()
154
Hälfte das Thal des Lab in entgegengesetzter Richtung, nämlich von Norden nach Süden, zu senkt.
Gegen Westen wird das Amseifeld von der Metoja oder der Ebene des weissen Drin durch die Höhenzüge getrennt, zwischen welchen die untere Drenitza dem Drin, die obere der Sitnitza zuläuft, doch satteln dieselben nach Boué’s Beobachtung an einer Stelle so tief ein, dass hier die Wasserscheide zwischen beiden Bächen, mithin zwischen Donau und Mittelmeer, nur mühsam bestimmt werden kann. Ein Missverständniss dieser Angaben Boué’s veranlasste uns, in den Albanesischen Studien [1] zu sagen, dass man durch diese Einsattung ebenen Fusses aus der Metojaebene zum Amselfelde gelangen könne, während die Mittelhöhe der ersteren nur 1000 Fuss, mithin 500 Fuss weniger als die des Amselfeldes betragen dürfte.
Unsere Ansichten über den westlich von der Metoja ansteigenden albanesischen Alpenknoten und die Bodenbildung von Albanien überhaupt haben wir in dem genannten Werke entwickelt.
Aus unseren Beobachtungen ergiebt sich, dass Grisebach sich das Niveau dieser Länder und namentlich die Wasserscheide zwischen Donau und Wardar zu niedrig gedacht habe, und dass wir daher der folgenden Argumentation desselben nicht beistimmen können, so weit sie sich auf diese Terrain Verhältnisse stützt. Er sagt nämlich I, S. 9, über die Stromengen der Donau bei dem eisernen Thore u. s. w.:
Es ist unmöglich, dass sich die Donau diesen Canal durch festes Gestein sollte ausgegraben haben. Die mittlere Höhe des linken Ufers unmittelbar über der Donau beträgt 800 Fuss, die des rechten 1500 Fuss. Da zu einem Stromdurchbruche wesentliche Bedingung ist, dass der Wasserstand bei der Katastrophe das Hinderniss an Höhe übertroften habe, so müsste man sich die Donau damaliger Zeit als einen See denken, der nicht blos Ungarn, sondern einen Theil von Deutschland erfüllt hätte. Aber so hoch gestelltes Wasser hätte einen tiefer gelegenen Weg nach Süden gefunden. Die niedrigsten Puncte der Wasserscheide zwischen der Donau und dem Wardar sind, wie aus meiner Niveaubestimmung von Üskjüb geschlossen werden darf, unzweifelhaft viel geringer, als irgend eine Kammhöhe im Karpathensysteme. Hieraus geht hervor, dass wenn nicht die Spalte zwischen dem Banate und Serbien ursprünglich gebildet und niedriger gewesen wäre als der Scheidepunct jener
1. I, S. 5.
![]()
155
„beiden Flussgebiete, die Donau hätte in den Golf von Salonich „fliessen müssen.“
Der niedrigste Punct [1] dieser Wasserscheide im Morawitzathale ergab aber nach unsern Messungen 1328 Fuss Meereshöhe. Fugen wir nun auch zu der von Grisebach angegebenen Kammhöhe der nördlichen Wand der Donauengen von 800 Fuss über dem Donauspiegel deren Meereshöhe nach Streffleur’s Messungen bei Orsowa mit 123 und beim eisernen Thore mit 118 Fuss, so ergiebt sich für den niedrigsten Punct der Donauwasserscheide ein Ueberschuss von 400 Fuss über die Kammhöhe jenes Theiles der Karpathen.
Uebersicht
der Niveauverhältnisse des Rinnsals der bulgarischen und vereinten Morawa vom Eintritte in das Quellbecken bei dem Dorfe Widdin bis zur Mündung in die Donau.
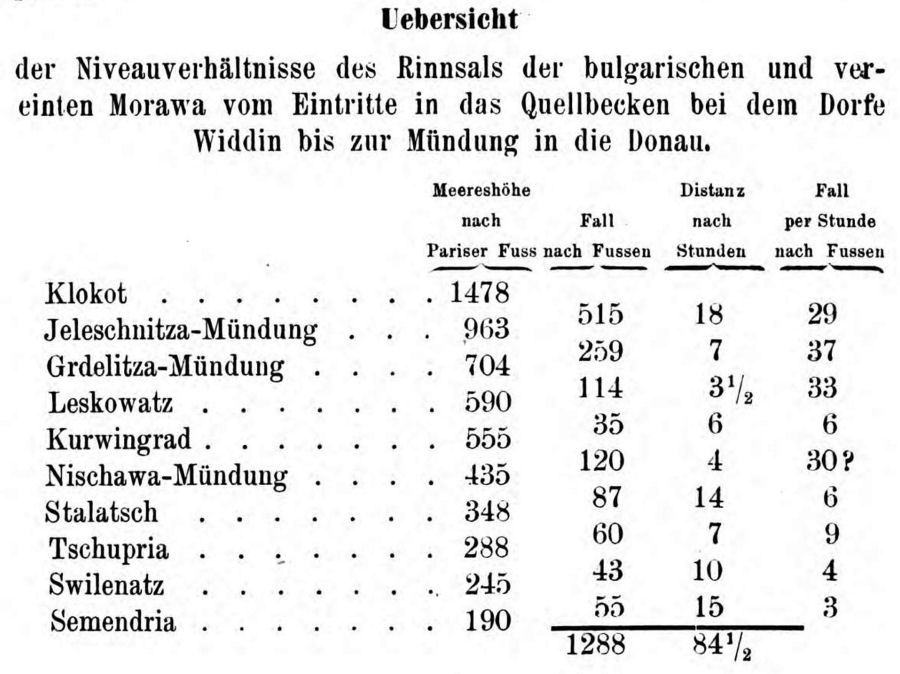
XXIII. Justinian’s Geburtsort.
Unser Auszug aus Skopia am Frühmorgen des 13. Novembers glich einer sibirischen Karawane zur Winterszeit. Dichter Nebel, hart gefrorener Boden, gelbdampfende, reifbedeckte Pferde, in Pelz
1. Die früher erwähnte Bifurcal-Verbindung des Donau- und Wardargebiets durch die Neredimka hat wenigstens 1500 Fuss Meereshöhe.
![]()
156
und Shawls vermummte Gestalten mit weissen Bärten und Haaren, schlürfende, türkische Reiterstiefel von rothem Leder an den Füssen, die über leichteres Fusswerk gezogen waren, und mächtige Pelzhandschuhe bis zum halben Vorderarme, vor deuen der Verfasser übrigens jeden Reisenden warnen möchte, welcher unterwegs Notata machen will, denn er laborirt seitdem an Gichtschmerzen in der rechten Hand.
Doch hatte der Frost wenigstens das Gute, dass er uns leicht über die kothigen Partien der sumpfigen Wardarebene weghalf. Wir longirten den Fluss, der sich in die weiche Ebene ein tiefes windungsreiches Bett gegraben hat, und erblickten in ihm auf kaum dreissig bis vierzig Schritte Entfernung mehrere Trupps wilder Gänse, welche sich in ihrem kalten, neblichten Nachtlager so gemüthlich fühlten, dass sie sich nicht die Mühe nahmen, vor uns aufsustehen. Wir Hessen sie unbehelligt, da die Flinten nur mit Vogelschrot geladen wasen. Zwei Stunden südlich von Skopia kamen wir an den neuen stattlichen Gebäuden vorüber, welche zum Depôt des Salpeters dienen, der aus den Sümpfen der Umgegend gewonnen wird. Die salpeterhaltige Erde wird ausgelaugt und das Wasser dann in Kesseln abgedampft. Dieses Gewerbe wird von Zigeunern in den Dörfern der Umgegend betrieben, welche ihr 'Erzeugniss gegen ein tarifmässiges Entgelt in diese Niederlage liefern müssen, von wo es durch Saumthiere in die grossherrlichen Pulverfabriken von Constantinopel gebracht wird.
Nach weiteren zwei Stunden erreichten wir, in gleicher Richtung zwischen dem Flusse und dem früher erwähnten Sumpfsee in der Südostecke der Ebene hinfahrend, unser erstes Ziel, das am Südrandende der Ebene gelegene Dorf Taor, bei welchem der Wardar aus der Ebene in ein Défilé tritt. Während unserer Anwesenheit in Wien hatte uns nämlich Herr Generalconsul von Mihanovich auf die grosse Namensähnlichkeit der Dörfer Taor und Bader mit den von Procop angegebenen Heimatsorten Justinians, Tauresium und Bederiana aufmerksam gemacht, und zu ihrer Untersuchung aufgefordert.
Wir gestehen, dass wir uns während der ganzen Reise auf den Besuch dieser Stelle gefreut haben, und dass wir sie mit einem Anfluge von Pietät betraten, wenn es gleich lange her ist, dass wir zum letzten Male das Corpus juris aufgeschlagen haben, und wenn wir auch für die Schwächen dieses Kaisers der Juristen keineswegs blind sind. Zwar erklärt sich die Schärfe, mit welcher die historische Kritik seine Regierung behandelte, als eine sehr berechtigte Reaction
![]()
157
gegen Abgötterei, welche die älteren Juristen mit Justinian getrieben haben, doch will es uns bedünken, als ob diese Reaction noch immer andauere und selbst neuere Behandlungen seines Lebens sich lieber in den Schatten- als in den Lichtseiten desselben bewegten. Denn Niemand dürfte läugnen, dass Justinians Regierung an und für sich betrachtet, trotz aller ihrer Flecken, eine der fruchtbarsten Oasen in der Wüste byzantinischer Geschichte bilde, dann aber erfüllt uns die Betrachtung jeder frisch und lebenskräftig in unsere Gegenwart eingreifenden Wirkung alter Thaten mit um so grösserer Ehrfurcht gegen deren Urheber, je weiter der Zeitabstand ist, welcher Wirkung und Ursache von einander trennt, denn leben und herrschen sie nicht in den Wirkungen ihrer Thaten auch auf dieser Erde fort, nachdem sich ihre Körperhülle längst in die letzten Atome aufgelöst hat? Justinians Gesetzsammlung erhielt uns aber das römische Rechtssystem, welches, weil es das absolute ist, einen der Hauptpfeiler der europäischen Civilisation ausmacht [1] und darum bildet sich Geschlecht auf Geschlecht an ihrem Studium selbst da, wo sie aufgehört hat, praktisches Recht zu sein. Doch herrscht Justinian nicht blos im fremden Occidente, er herrscht auch in dem eigenen Reiche, wenn auch in anderer Richtung fort, denn er ist der Erbauer der noch erhaltenen St. Sophienkirche, in welchem Baue sich der griechische Christ seine Kirche verkörpert denkt, und ihr Name erweckt daher in seinem Herzen weit tiefer greifende Gefühle als der Name St. Peters bei dem Katholiken, weil dieser in seiner Hauptkirche nur das Symbol der in ungestörter Herrlichkeit triumphirenden Kirche erblickt und dieselbe keine in die Herzen greifende Geschichte hat. Wer die Levante näher kennt, wird uns die Zauberkraft, die in jenem Namen liegt, bestätigen.
Die acht von Bulgaren bewohnten Häuser des Dorfes liegen auf dem letzten schmalen Vorsprunge der linken Wand des Défilé’s in die Ebene, welche etwa 60 Fuss steil in den Wardar abfällt. Hier war also kein Platz für Procop’s Tetrapyrgion, doch erzählten die Bauern, dass sie beim Beackern der auf der Platte oberhalb des Dorfes gelegenen Felder auf Cementsubstructionen stiessen, und bejahten unsere Frage, ob diese ein Viereck bildeten, doch möchten wir durch diese Bejahung die Frage noch nicht als unwiderruflich entschieden betrachten. Die auf der Platte lagernde Schneedecke
1. Eine andere Frage ist freilich die, ob wir Deutsche den Besitz dieses absolut besten Rechtssystems mit dein Verliest selbstständiger Rechtsentwicklung nicht zu theuer erkauft haben.
![]()
158
machte die Untersuchung derselben durch den Augenschein unmöglich. Weiter aber erzählten sie aus freien Stücken, dass zu dieser alten Festung eine Wasserleitung geführt habe, deren aus Backsteinen gemauerter Canal viereckig und mit Ziegelplatten belegt sei; Thonröhren fänden sich in demselben nicht vor.
Die Terrasse, auf welcher diese alte Befestigung gestanden haben soll, mag etwa 60 bis 80 Fuss höher liegen, als das Dorf, und erscheint daher für ein zur Deckung des Flussdéfllé’s bestimmtes byzantinisches Castell sehr geeignet. Unsere Fragen nach alten Inschriften wurden Anfangs verneint, da wir aber wiederholt auf diese Frage zurückkamen, erinnerte sich der Ortsvorsteher an den Altarstein der kleinen Dorfkirche, welche links von dem zum Dorfe aufsteigenden Wege etwa auf halber Höhe der Dorfstelle steht. Er zeigte sich als ein viereckiges, roh gearbeitetes Postament, dessen Vorderseite, nachdem sie mit Schnee tüchtig abgerieben war, etwa sechs Zeilen Inschrift erkennen liess. Leider stand das Postament auf dem Kopfe, und ist die Inschrift bereits so verwischt, dass wir nur mit grosser Mühe einige roh gearbeitete slavische Charaktere erkennen konnten. Das Postament dünkte uns ursprünglich nicht bestimmt, eine Inschrift zu tragen, und wir vermuthen daher, dass diese erst in späteren Zeiten darauf eingegraben wurde.
Wir frühstückten in dem Dorfe und wurden während desselben von einigen hübschen Jungen mit neugierigen Augen betrachtet; dies veranlasste den Major zu der Frage, ob nicht etwa Justinian in seiner Kindheit auf derselben Stelle einen oder den andern Reisenden eben so neugierig betrachtet habe, und ob es undenkbar sei, dass der Stammbaum dieser kleinen Bulgaren die beiden Kaiser Justinus und Justinianus einbegriffe. Wir konnten diese Frage nicht verneinen, denn beide Namen sind bekanntlich Latinisirungen ihres ursprünglichen Namens Uprauda, und die früheren Versuche, die beiden Kaiser durch die Verdeutschung dieses Namens mit „aufrichtig“ zu Gothen zu machen, sind von der Linguistik beseitigt, welche den Namen zu dem slavischen pravda justitia und uprava recte, und den von Justinian’s Vater Istok zu serbisch исток sol oriens stellt [1].
Ueber das Défilé, in welches hier der Wardar aus der Ebene eintritt, konnten wir ausser den darin gelegenen Orten nur so viel erfahren, dass eine Stunde unterhalb Taor dasselbe sich bedeutend
1. Wuk Stephanowich, Kleine serbische Grammatik, verdeutscht und mit einer Vorrede von Jakob Grimm, pag. IV.
![]()
159
verenge, und darin eine die Schifffahrt sehr erschwerende Stelle sei, an der sich, wenn wir richtig verstanden, die Strömung wider einen quer vorstehenden senkrechten Felsen breche und zu einer Wendung gezwungen werde, doch sei in neuerer Zeit durch mehrere daran vorgenommene Sprengungen den Schiffen der Durchweg erleichtert worden. Den Weg durch das Fluss-Défilé bei dieser Jahreszeit schilderten die Bauern als für Reiter unpracticabel, und wir fuhren daher zwischen dem Südufer des entenreichen Sumpfsee’s und dem den Südrand der Ebene bildenden Höhenrücken bis zu der Stelle, wo dieser gegen Osten abfällt und zwischen sich und den westlichsten Buckeln der Mustapha Owassi ein ziemlich breites, in südlicher Richtung zum Rinnsale der Ptschinja führendes Thal lässt. Durch dasselbe könnte, wie schon erwähnt, mit geringen Kosten ein Canal von dem See in diesen Fluss geleitet werden, der ersteren sehr rasch trocken legen würde.
XXIV. Kaplan-Chan.
Am Südende der vorerwähnten, die Skopiaebene mit dem Ptschinjathale verbindenden Einsattlung und am rechten Ufer dieses Flusses liegt das Dorf Kaplan, in dessen Chan wir übernachteten. Beim Eintritte in denselben fiel uns ein Eisenschimmel durch seinen eben so schönen als kräftigen Bau auf, welcher nebst zwei andern tüchtigen und gut gesattelten Pferden im Hofraume zur Abkühlung herumgeführt wurde. Wir fragten also den Chandschi nach dem Besitzer dieser Pferde. Der Chandschi war, wie alle seine Collegen an den Strassen von Skopia nach Salonik und Bitolia, aus Zachori in Epirus, und da er hörte, dass wir griechisch sprachen und seine Heimath kannten, fasste er sogleich Vertrauen, und erzählte, dass der Besitzer jener Pferde ein reitender Räuber aus Unter-Dibra sei, welchen er sehr wohl kenne, weil er schon öfter bei ihm übernachtet habe.
Diese Auskunft musste uns im höchsten Grade überraschen, denn wir glaubten mit allen Gewerben der Halbinsel bekannt zu sein, und hier bot sich eines, von dem wir noch nie etwas gehört hatten. Wir erkundigten uns also sofort nach demselben und erfuhren, dass dieses Gewerbe namentlich in Unter-Dibra einheimisch sei und sich besonders mit dem Pferdediebstahl befasse, ohne dass deswegen die Industrieritter anderweitige Gelegenheiten zur Bereicherung
![]()
160
verschmähten. Dieselben präsentirten sich in der Regel vortrefflich beritten und von mehreren Dienern begleitet. Sie seien mit einem regelmässigen Passe versehen, und betrügen sich überall, wo sie einkehrten, als anständige Reisende. Ihre Coups machten sie, wenn es möglich sei, vor Mitternacht und eilten dann, so rasch sie könnten, auf Nebenwegen zu der ihnen zur Bergung und zum Absätze des Raubes am geeignetsten erscheinenden Diebshöhle, welche über die Halbinsel zerstreut seien. Doch sei dies selten die dem Raube nächst gelegene, und rasteten die Räuber in der Regel erst, wenn sie in einer anderen Provinz angekommen sind. Aus diesem Grunde sind daher tüchtige Pferde das erste Erforderniss für die Dibraner Industrieritter, welche lebhaft an ihre paläontologischen Collegen erinnern, die in den englischen Romanen des verflossenen Jahrhunderts eine so grosse Rolle spielen. Sollte diese Species zu der Classe von Erscheinungen gehören, welche sich im Uebergange aus dem Mittelalter in eine neue Zeit bilden? Denn die Türkei ist gegenwärtig in diesem Uebergangsstadium begriffen, welches für das übrige Europa bereits in der Vergangenheit liegt. Das Mittelalter schliesst für dieses Reich mit dem Beginne der Reformen, wie es für Griechenland mit dem Beginne der Revolution endet [1].
Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir auch, dass unsere Leute in Skopia und Prischtina selbst unter Tags ein Auge auf die Pferde hatten, obwohl der Chan, in dem sie standen, mitten in der Stadt lag, und sie des Nachts im Stalle schliefen, weil es schon vorgekommen ist, dass fremde Pferde sowohl bei Tag als bei Nacht aus den Ställen der Stadt gestohlen worden sind.
Ueberhaupt ist der Vieh- und namentlich der Pferdediebstahl eine auf der ganzen Halbinsel verbreitete und meist wohl organisirte Industrie. Sie erzeugte z. B. noch vor zwanzig Jahren einen regen Verkehr zwischen der Provinz Messenien im Peloponnes und dem türkischen Thessalien und Macedonien, an dessen Unterdrückung die griechischen Behörden damals vergebens arbeiteten. Der jetzige Zustand dieses Industriezweiges ist uns nicht bekannt. In Albanien befassen sich namentlich die Zigeuner der hinter Awlona und Durazzo gelegenen Mussakia mit demselben; dass es aber auch wohlhabende Reisende gebe, welche hauptsächlich in diesem Artikel machen, das erfuhren wir im Kaplan-Chan zum ersten Male.
Dass die dort mit uns eingekehrten Gäste es nicht auf uns abgesehen haben können, darüber waren wir mit dem Chandschi einverstanden,
1. Albanesische Studien I, S. 309.
![]()
161
und das zeigte sich auch am folgenden Morgen, da sie bei unserem Abgänge noch gar nicht sichtbar waren, aber wir vermuthen, dass diese Begegnung auch den herzhaftesten mit den hiesigen Verhältnissen weniger vertrauten Beisenden beunruhigt hätte. Wir hatten überhaupt nirgends Bäuberfurcht ; wir wussten, dass die Leute Beeilt hatten, wenn sie behaupteten, dass wir überall sicher wären, weil die Bäuber sehr wohl wüssten, dass unsere Gurten weniger gespickt seien, als die der reisenden Kaufleute, und dass ein Coup gegen uns sämmtliche Regierungsorgane der Provinz gegen sie auf die Beine bringen würde. Dieser Calcul schützte uns, nicht die paar Beiter, die uns begleiteten, denn was sollten diese gegen einen Hinterhalt thun, den uns an einer schwierigen Stelle ein Dutzend Bäuber legten? Wir waren auch fest entschlossen, in einem solchen Falle keinen Widerstand zu leisten, und hatten unsere Leute danach instruirt, denn die Partie ist dann viel zu ungleich. Wir fühlten uns aber in dieser Hinsicht so sicher, dass wir es meistens versäumten, die zu solchen Hinterhalten oft benutzten und daher bekannten Oertlichkeiten recognosciren zu lassen, bevor wir sie betraten, und der Erfolg bestätigte unsere Zuversicht, denn wir erfuhren auf der ganzen Reise nicht die geringste Behelligung, obwohl wir mehrmals von Bäuberbanden hörten, die in den Gegenden hausten, durch welche wir kamen. Die Behörden lassen sich zwar die Verfolgung derselben in der Begel angelegen sein, aber das Uebel ist zu tief gewurzelt, um seine gänzliche Ausrottung so bald erwarten zu lassen. Die Türkei gleicht auch in dieser Hinsicht den europäischen Staaten bei ihrem Austritte aus dem Mittelalter, und uns erscheint daher die an die grossherrliche Begierung gestellte Forderung nicht billig zu sein, dass sie durch einen Zauberschlag tausendjährige sociale Auswüchse vertilge und in ihrem Innern eine eben so saubere und geordnete Administration herstelle, an deren Entwicklung in Europa der Schweiss und das Blut von Jahrhunderten klebt. Ueberhaupt muss das Treiben so mancher die Türkei besprechender Beformtheoretiker oft die Ungeduld Derjenigen erregen, welche mit den hiesigen Landesverhältnissen näher bekannt sind, und möchte man ihnen zurufen: kommt doch erst an Ort und Stelle, und studirt das Material, das ihr reformiren wollt, seht zu, was ihm Noth thut, und wie viel es verträgt, und verlangt nicht, dass der Wallfisch nach euern Becepten fliegen lerne. Zu thun wäre noch genug, das ist keine Frage, aber eure Vorschläge brächten nur die alte Maschine in’s Stocken, ohne eine neue zu schaffen, und ist euch dies theilweise leider schon geglückt.
![]()
162
Während Kiepert, vermuthlich nach Grisebach [1], den Kaplan-Chan an die Mündung der Ptschinja in den Wardar versetzt, liegt derselbe von ihr zwei Stunden stromaufwärts. Der Ptschinjabach, welchen wir hei dem Kloster von Sweti Prochor bereits erwähnt haben, behält nach Aufnahme der Bäche von Egri Palanka und Kumanowa diesen Namen bis zur Mündung in den Wardar bei, und der ihr von Kiepert gegebene Name Kriwa Rjeka war an ihrem unteren Laufe nicht zu erfragen.
Etwa drei Viertel Stunden südwestlich vom Chane liegt auf einem Vorsprunge des südöstlichen Abfalles des Höhenzuges, etwa eine Viertelstunde vom rechten Ufer der Ptschinja, das Dörfchen Bader, welches eine Stunde östlich von Taor fallen soll, doch kreuzt der Weg dahin den Kamm des zwischen ihnen liegenden Höhenrückens ; wir liessen dasselbe unbesucht, denn wenn daselbst auch antike Substructionen vorhanden sind, was die einen behaupteten, die andern läugneten, so waren sie für uns jedenfalls durch die auf ihnen lastende Schneedecke unsichtbar, und von dortigen Inschriften wollte Niemand etwas wissen. Dagegen erhielten wir in Welese die Copie einer sehr beachtenswerthen Inschrift aus der Kirche des Klosters St. Johann, welches im linken Mündungswinkel der Ptschinja in den Wardar, also in der Nachbarschaft von Taor und Bader, liegt, denn sie gibt den Kaiser Justinian als den Stifter dieses Klosters an. Der geschichtliche Werth dieser Angabe mag sehr zweifelhaft sein, weil die Inschrift selbst in türkischer Zeit verfasst ist oder, wenn man sie uns richtig übersetzt hat, den Arzt eines türkischen Pascha’s, welcher dessen Gattin von der Unfruchtbarkeit heilte, als den Wiederhersteller des von Justinian gegründeten Klosters nennt. Sie zeigt aber jedenfalls so viel, dass der Name des Kaisers Justinian sich zur Zeit ihrer Abfassung traditionsweise in dieser Gegend erhalten hatte, und als der local populärste Kaisername mit der Gründung des Klosters verbunden wurde. Der Name Justinian’s findet sich also in der Nachbarschaft der Dörfer Taor und Bader, wenigstens traditionsweise erhalten, und diese Thatsache dürfte der Annahme, dass diese Namen Verstümmlungen von Prokop’s Tauresium und Bederiana seien, noch grössere Wahrscheinlichkeit verleihen. Auch sind dies nicht die einzigen in diesen Gegenden erhaltenen alten Ortsnamen, denn ausser dem rein erhaltenen Skopia erkennen wir nach Leake’s Vorgang Bylazora in Welese und Astapus in Istib wieder.
1. I, S. 225.
![]()
163
Unser Weg zum Wardar führte über die Höhenrücken, welche nach Grisebach [1] den äussersten Hand der, Mustapha Owassi genannten und sich zwischen Kumanowa, Welese, Negotin und Istib ausdehnenden Ebene bilden.
„Diese ist völlig verschieden von dem fruchtbaren Kingbecken des Skardus, und würde mit grösserem liechte flaches Hügelland genannt werden. Von dem dominirenden Puncte der Strasse blickt man zwar nach Osten auf einen unbeschränkten Horizont, aber nirgends ist der Boden wagerecht, sondern überall auf das unregelmässigste zu flachen Mulden und Curven gesenkt und gehoben. In dieser Beziehung ist die Ansicht ganz der von manchen Gegenden der Lüneburger Heide ähnlich, nur dass die Hügel- und Thalbildung einem grösseren Massstabe folgt. Doch erheben sich die Höhenpuncte schwerlich irgendwo mehr als 500 Fuss über den Wardar, gegen den sie dann endlich in steilen Wänden abfallen, während im Innern nur sanfte Neigungswinkel sichtbar sind. Diese grosse, wellig gebaute Fläche erscheint dem Reisenden als eine traurige, unfruchtbare Einöde. Ausser den Dörfern des dicht bevölkerten Wardarthales ist weit und breit keine Ortschaft sichtbar. Nur die tieferen, dem Strome benachbarten Mulden stehen in Cultur, der geneigte Boden wird nirgends benutzt. Er ist kahl oder mit ärmlichen Gebüsch von niedrigen Eichen und Paliurus bewachsen.“
Wir entlehnten diese Schilderung dem berühmten Botaniker, der es, wie Fallmerayer, in Wollen zu malen versteht, weil uns Schnee und Nebel nur hie und da einen Blick in die nächste Umgebung der Strasse erlaubte, und bitten nur den Leser, sich die Mustapha Owassi nach dieser Schilderung nicht vollkommen unbewohnt zu denken; freilich erscheint sie dem Durchreisenden so, wenn er sich aber näher nach den auf ihr liegenden Ortschaften erkundigt, so möchte sich, nach den von uns in den statistischen Notizen aus der Nachbarschaft der Strasse gegebenen Proben zu urtheilen, die ganze Ebene wohl ziemlich mit Ortsnamen füllen.
Aus dieser Schilderung ergibt sich, dass der Weg von Kaplan-Chan bis zum Wardarthal nicht unterhaltend war. Er kreuzte ohne Unterbrechung die sich aus der Mustapha Owassi nach der Ptschinja oder dem Wardar ziehenden, von Nebel und Schneegestöber umdüsterten mageren Hügelbuckel und die zwischen ihnen gelegenen Senkungen, und wir liessen die ganze Strecke mit Vergnügen hinter uns, als wir endlich in der kleinen Kesselebene anlangten, welche der Wardar durchschneidet, nachdem er aus dem Défllé von Taor
1. I, S. 224.
![]()
164
getreten ist. Diese Ebene mag kaum drei Viertel Stunden lang und etwa halb so breit sein, und ist im Norden, Osten und Süden von felsigen Hügeln eingesehlossen, gegen Westen aber von Wellenrücken begrenzt, über welche ein von Westen nach Osten bis in die Nähe des Wardar ziehender Gebirgszug mit scharf gezackten Contouren hervorragt. In Taor begriff man die ganze, die Ebene von Skopia gegen Westen zu im Bogen umkreisende Bergkette unter dem Namen Karschiak, hier wurde uns die erwähnte Kette Goleschnitza Planina genannt, doch wissen wir nicht, ob dieser als Gemeinname allgemeine Anerkennung findet.
Nach den Angaben über die nordwärts von dieser Kette gelegene Gegend und der Ansicht von der Höhe des Kolnik in das Wardarthal möchten wir vermuthen, dass die Goleschnitza Planina mit der Salkowa Planina, ihrer westlichen Fortsetzung, die Querverbindung zwischen den verschiedenen von dort aus gesehenen, in der Richtung von Süden nach Norden laufenden Parallelketten bilde, in deren Längenthäler die Baditska Rjeka und die Markwa dem Wardar zufiiessen, denn diese Thäler senken sich von Süden nach Norden, also in der dem Wardar-Rinnsale entgegengesetzten Richtung. Wahrscheinlich würde auch eine nähere Untersuchung die Goleschnitza als einen Zweig der Babunakette herstellen, von welcher wir vermuthen, dass sie nordwärts zwischen den Flüssen Markwa und Treska laufend, sich bis zu dem westlich von Skopia gelegenen Karschiakgipfel erstreckt und die rechte Wand des gleichfalls von Süden gegen Norden gesenkten Treskadéfilé's bildet.
ihn aus dem Dorfe Baditschka gebürtiger Maurermeister, den wir über die Markwa ausfragten, erzählte uns, dass Marko Kral die aus einem kleinen See kommende Quelle dieses Baches, welche früher nach Welese floss, vermittelst eines in den Berg gehauenen Canals dem Kloster St. Demetrius zugeleitet habe, und wir glauben in dieser Sage den Beleg für die Annahme zu finden, dass durch die Goleschnitzakette ein von Süden nach Norden streichender Querriss läuft, und dieser das Bett der auf der Südseite des Gebirges entspringenden Markwa bildet [1]. Dieser Mann bekannte sich, obwohl Albanese, zur griechischen Kirche, und sagte aus, dass die ganze christliche Gemeinde seines Heimatsdorfes in dem gleichen Fall sei. Es war dies die erste Ausnahme von der Regel, dass was von Nordalbanesen christlich sei, sich zur katholischen Kirche bekenne, während die christlichen Mittel- und Südalbanesen zur griechischen Kirche gehören.
1. S. statistische Notizen über die Markwa in der ersten Ausgabe.
![]()
165
Eine nähere Untersuchung des Osthanges des Skardus dürfte aber vermuthlich die Zahl dieser Ausnahmen vermehren, obwohl unserem Berichterstatter keine solche weiter bekannt war. Ueberhaupt aber fanden wir, dass das albanesische Element nicht nur den Skardus überschritten, denn Tetowo, das Quellbecken des Wardar, ist ein albanesisch - bulgarischer Mischbezirk, sondern dass es in dem ersten südlich von Skopia gelegenen Défilé des Wardar bis zu dem rechten Ufer dieses Flusses reicht. Vermuthlich wohnen Bulgaren nur an den Rändern des von dem Wardar, der Treska und der Goleschnitzakette gebildeten Dreiecks, und hausen in dessen Kerne nur Albanesen. Hier wie überall sitzen also die Albanesen in den mageren Bergen und die Bulgaren in den fetten Ebenen.
Dies sind aber bereits Landschaften, in welchen unbezweifelt die Hand der byzantinischen Eroberer nach Kaiser Basilios Bulgaroktonos schwer auf den unterjochten bulgarischen Erbfeinden gelegen hat, und auf diese Zeit folgte dann die türkische Eroberung. Ist es nun denkbar, dass während dieser Katastrophen die Bulgaren sich nicht in die schwer zugänglichen Berge geflüchtet, und sich in diesen angesiedelt hätten, wenn sie nicht bereits besetzt gewesen wären? und dass die Albanesen, als sie später über ihre Grenze quollen, die saure und wenig einträgliche Arbeit, jene bulgarischen Hochländer aus ihren magern Sitzen zu vertreiben, der Eroberung der fetten Ebenen vorzogen, die sie ja zeitweise besitzen? [1] Von je mehr Seiten die vorliegende ethnographische Frage betrachtet wird, um so mehr Gründe finden sich für die Antwort, dass die Albanesen im Osten des Skardus die Reste der von den Bulgaren in die Berge gedrängten Ureinwohner seien.
Jener Maurermeister aus Baditschka war mit seiner Familie vor Kurzem nach Skopia gezogen, weil ihm Räuber seine beiden Kinder gestohlen hatten, und er sie trotz der thätigen Bemühungen der Behörden nur gegen ein Lösegeld von 6000 Piaster wieder erhalten konnte. Da er ein wohlhabender Mann ist, so zog er aus Furcht vor Wiederholungen in die Stadt. Menschenraub zur Erpressung von Lösegeld ist eine auf der ganzen Südosthalbinsel herrschende uralte Räuberpraxis.
1. Albanesische Studien I, S. 318.
![]()
166
XXV. Welesa.
Wir sind vor den Thoren der Stadt Welese stehen geblieben, und es möchte nun Zeit sein, den Leser in dieselbe einzuführen. Sie liegt an dem Südende der erwähnten kleinen Kesselebene, doch nicht mehr in derselben, denn an der Stelle, wo der Wardar aus ihr in ein neues Défilé eintritt, baut sie sich dessen beide Wände aufwärts, und wird daher von dem Rinnsal des Flusses in zwei Theile gespalten. Die Natur selbst scheint diesen Ort zur Brücke bestimmt zu haben, weil sie hier dem Flusse ein enges Rinnsal und feste, hohe Felsufer gab ; so lange der Mensch Brücken baut, mag daher hier eine solche gestanden haben, und sie fehlt auch jetzt nicht, so schlecht, ja halsbrechend sie auch beschaffen ist, und von ihr erhielt die Stadt ihren türkischen Namen Koprili oder Kjüprülü. Die Albanesen und Bulgaren nennen sie Weles, doch sind im Munde der ersteren beide e gedeckt, gleich den deutschen Auslauten in dieser, hatte u. s. w. Sie ist ihm weiblichen Geschlechts, denn wenn er ihr den Artikel ansetzt, sagt er Welesa, d. h. die Stadt Welles; aus diesem Grunde muss der unbestimmte Nominiativ auf ein gedecktes e auslauten. Da nun die weiblichen Diminutive alle auf eçe, und bestimmt auf eça enden [1] und der Name zwei eigentümliche albanesische Vocale hat, so möchten wir denselben der albanesischen Sprache vindiciren, wenn wir auch die Bedeutung des Stammes nicht erklären können. Die Byzantiner und Neugriechen verlegen den Ton auf die Endsylbe und schreiben bald Βελεσά, bald Βελεσσός.
Sobald wir den Namen als albanesisches Wort fassen und bedenken, dass die Hellenen das gedeckte albanesische e durch andere Laute ersetzen mussten, so erscheint Leake’s [2] Zusammenstellung von Welesa mit dem alten Bylaçora Βυλαζωρα als ganz unbedenklich. Auffallend ist nun, dass ure, bestimmt ura im Albanesischen die Brücke heisst, und dass sich demnach Bylaçora mit Wellesbrücke übersetzen liesse, wenn wir eine ähnliche albanesische Composition beibringen könnten, in welcher, wie im Türkischen, der Genitiv vor dem Nominativ steht. Bei allen uns bekannten albanesischen Compositis folgt jedoch der Genitiv dem Nominativ nach.
1. Wir substituiren nur der Bequemlichkeit wegen den albanesischen ç, alt- und neugriechisch ζ, das s der bulgarischen Aussprache.
2. Travels in Northern Greece III, 470.
![]()
167
Die Slaven könnten auch hier ihrem Wolus oder Welus geopfert haben.
Von Welesa fielen alle Einholungen und sonstigen Ceremonien weg, die sich traditionsweise in das Paschalik von Prisrend übertragen hatten, denn wir betraten als unbekannte Grössen das Gebiet des Rumili Walisi, und der Polizeichef (Kapi Buluk Baschi), welcher in Abwesenheit des Murdir’s fungirte, sagte daher zu dem Kawassen, welchen wir um ein Absteigequartier zu ihm geschickt hatten, wir sollten doch nur im Chan bleiben, wo wir abgestiegen wären. Als er aber sich endlich zu uns bequemte und den Firman gelesen, wurde er geschmeidig und brachte uns sogleich in dem stattlichen Hause eines wohlhabenden empirischen Arztes unter, wo wir drei mit keinerlei Officialia behelligte Tage unseren Arbeiten widmen konnten, und uns nur besseres Wetter zu wünschen übrig blieb, denn dieses besserte sich erst am letzten Nachmittage unseres Aufenthaltes so weit, dass wir einen kleinen Ausflug nach dem etwa zwanzig Minuten stromabwärts von der Stadt am rechten Flussufer gelegenen Kloster St. Demetrius wagen konnten, wohin man uns auf unsere Frage nach Inschriften verwies, weil sich dort die einzige beschriebene Steinplatte finde, die man in der Stadt und deren Umgebung kenne.
Wir stiegen also von unserem auf der linken Thalwand zwischen höher und niederer gelegenen Nachbarn eingepferchten Hause zu der längs des Flusses laufenden, engen Bazarstrasse herab, deren reges Leben von der Handels- und Gewerbthätigkeit der Stadt Zeugniss gab, und über die sehr verwahrloste hölzerne Brücke, welche jedoch die mit deren Schwächen vertrauten Pferde ohne Anstand passirten. Sie gewährt den besten Ueberblick über das von den beiden Ufern aufsteigende Häuserconglomerat, welches einen eigenthümlichen mittelalterlichen Eindruck auf uns machte, denn hier gab es wenig todte Mauern, überall sahen die in dichten Reihen, wie zu einem Schauspiele zusammengedrängten Häuser aus vielen Fenstern auf den Strom herab, und wenn auch wenig oder keine neuen Toiletten unter ihnen zu finden waren, so zeigte ihr verjährtes und mitunter verkommenes Aeusere einen von allem bisher Gesehenen abweichenden Charakter, von dem wir uns jedoch keine klare Bechenschaft geben konnten. Ihre Zahl ist sehr beträchtlich, sie wurde uns auf 3800 angegeben, von welchen zwei Drittel christlich und ein Drittel muhammedanisch sind. Unter den ersteren sind nur zehn walachische, alle übrigen gehören Bulgaren. Bei den Muhammedanern soll das Türkische Hauptsprache sein. Juden gibt es keine, und
![]()
168
an Zigeunern sollen nur zwanzig Familien als Schmiede in der Stadt wohnen. Welesa ist die einzige Stadt dieser Gegenden, in welcher und zwar schon von Alters her das Regiment mehr in den Händen der Christen als der Muhammedaner ist, und die ersteren sich daher viel freier bewegen als an anderen Orten.
Wir zählten von der Brücke aus fünf Minarets und einen Stadtuhrthurm. Im Flusse liegt kurz vor seinem Eintritte in das Défilé eine dicht mit Weiden bewachsene Erdinsel und am Südende der Stadt eine zweite ähnliche; vermuthlich haben beide ein Felsgerippe, aber auch mit diesem lässt sich ihre Bildung gerade an dieser Stelle schwer erklären, denn der Strom hat hier wie überall, wo wir ihn sahen, einen sehr raschen Lauf, und wenn sich auch das Hochwasser beim Eintritte in die Enge an den Bändern staut, so muss es, sollte mau denken, in der Mitte um so weniger Zeit zur Inselbildung haben. Dieser Einwand wird jedoch durch die Existenz dieser Inseln widerlegt, und wir wollen daher die Erklärung ihrer Bildung einem Kundigeren überlassen.
Von der Brücke wandten wir uns links, und gelangten durch enge, abschüssige Gässchen an das südliche Ende der Stadt, wo wir rechts über uns in einer Höhe von etwa 150 Fuss die in eine Falte der felsigen Thalwand eingebaute neue Stadtkirche erblickten, welche dem heiligen Pantaleon geweiht ist; ihr gegenüber steht auf dem Kamme des linken Ufers die alte Kirche St. Spass. Etwa fünf Minuten von dem Südende der Stadt kreuzten wir den Topolabach bei seiner Mündung in den Wardar. Dieser Bach kommt aus einem fast senkrechten Querriss der das rechte Flussufer bildenden Felskette, und soll in der Schlucht zwölf Mühlen treiben ; wir sahen bei unserer Abreise von Welese auch das Eingangsthor dieser Schlucht. Fünf Minuten weiter führte uns der Weg zwischen zwei verfallenen kleinen Kirchen durch, von denen die eine auf einer Inselklippe hart am rechten Ufer liegt. Sie gehören vermuthlich zu den 36 Kirchen der alten Stadt Welese, welche sich zwischen diesem Punkte und dem Kloster die westliche Thalwand des Flusses aufwärts zog, und in deren Umkreis man noch die Stellen bezeichnet, wo die Citadelle und die Metropole gestanden haben.
Zu welcher Zeit und aus welchem Grunde aber die Stadt von diesem au ihren gegenwärtigen Standort verlegt wurde, wusste Niemand anzugeben. Der Sinn für örtliche Geschichte und Sage scheint überhaupt den Welesanern noch nicht aufgegangen zu sein, denn alle unsere Fragen in dieser Dichtung blieben unbeantwortet. Doch thaten wir ihnen Unrecht, sie sogar der Vergesslichkeit gegen
![]()
169
ihre berühmten Landsleute, die Koprili’s, zu beschuldigen, welche dem türkischen Reiche so viele tüchtige Grossvesire geliefert und diese Würde in ihrer Familie so zu sagen erblich gemacht hatten. Denn wir ersahen später aus Hammer, dass diese Familie, obwohl von albanesischer Abstammung, ihren Namen nicht von diesem am Wardar, sondern von einem am Halys in Anatolien gelegenen Koprili ableitete, wohin ihr Stammherr aus Albanien eilige wandert war.
Das Kloster des St. Demetrius macht einen sehr freundlichen Eindruck, denn die kleine Kirche ist frisch restaurirt und die freundliche Wohnung des Klosterabtes und das Gästehaus sind ganz neu aufgebaut. Links von ihrem Eingänge ist die vorerwähnte slavische Inschrift eingemauert [1]. Das Personal des Klosters beschränkt sich auf den Abt, einen freundlichen, aber dem Trünke ergebenen alten Mann, und seine Dienerschaft.
Wir arbeiteten in Welesa den Tag durch, und verbrachten den Abend um ein grosses rundes Kohlenbecken aus Kupfer (Mangali) gelagert in der Gesellschaft des Wirthes und seiner Freunde, welcher uns auch den Tag über durch Herbeischaffung ortskundiger Leute und Dollmetscher von grossem Nutzen war. Unser Hauptzweck, von den hiesigen Schiffern Nachrichten über den Lauf des Wardar einzuziehen, blieb jedoch unerreicht. Schon in Skopia hatten wir uns erfolglos nach solchen umgethan, nachdem wir erfahren hatten, dass der Wardar beschilft werde. Dort vertröstete man uns auf Welesa, ihrem eigentlichen Sitze, und hier konnte weder der Hauswirth, noch der Polizeichef einen verständigen Mann dieses Gewerbes auftreiben, sie waren alle abwesend; man vertröstete uns also auf Salonik, wo unsere Erkundigungen nach ihnen gleich erfolglos waren. Wir konnten daher über diese Wardarschifffahrt nur so viel erfahren, dass dieselbe sehr jung sei, denn die ersten Versuche, von Skopia und Welesa Getreide nach Salonik zu verschiffen, wurden erst vor einigen Jahren gemacht. Da diese aber glücklich ausfielen und die hohen Getreidepreise während des letzten russischen Krieges den Unternehmungsgeist steigerten, so wurden während der Kriegszeit grosse Massen Getreide auf dem Wardar nach Salonik geführt. Nachdem aber seit dem Frieden die Getreidepreise wieder gefallen sind, ist auch diese Ausfuhr sehr in Abnahme gekommen, weil sie, wenn überhaupt, nur einen sehr geringen Gewinn bietet.
Das Getreide wird auf Kähnen von Skopia, namentlich aber von Welesa aus bis zur Mündung des Wardar gebracht und dort
1. S. Anhang der ersten Auflage.
![]()
170
auf Kaïk’s verladen, welche es zur See nach Salonik führen. Ein solcher Wardarkahn hält in der Regel 240 Schinik Getreide zu je 10 Okka (die Okka ist 2 Pfd. 9 Loth bairisch), und seine Herstellung kostet in Welesa 500 bis 600 Piaster, an der Mündung aber wird er kaum für ein Zehntel seiner Baukosten losgeschlagen, denn der Wardar ist für die Bergfahrt zu reissend. Das Holz zu diesen Kähnen wird entweder den Wardar herabgeflösst, oder per Achse von Bitolia und Prilip gebracht ; das letztere wird vorgezogen [1].
Der Kahn wird in der Regel von zwei Männern geführt, welche die Nacht über anlegen; die schwierigste Stelle für die Schifffahrt ist die schon früher erwähnte Enge in dem Défilé zwischen Skopia und Welesa. Das sogenannte eiserne Thor, Demir Kapu und die Zigeunerenge, durch welche der Wardar in die Küstenebene eintritt, soll keine besonderen Schwierigkeiten bieten und bis jetzt überhaupt noch kein Schiffer verunglückt sein. Der Verlust an Getreide von Welesa bis Salonik wird nur auf zwei Percent veranschlagt.
In Welesa sind alle herkömmlichen städtischen Gewerbe wohl vertreten, doch besteht die Hauptindustrie der Stadt in Branntweinbrennerei. Dies Product wird aus Wein destillirt, denn die Stadt gilt nach Trnowa in Bulgarien für die weinreichste der ganzen Südosthalbinsel. Ihr Weingebiet wird auf 12.000 Donum’s angegeben, welches Landmass, bekanntlich dem griechischen Stremma entsprechend, 40 Schritte per Quadratseite zählt. Man rechnet tausend Rebstöcke auf das vollbestellte Donum. Die Stadt soll 6000 Lasten zu je 80 Okka Branntwein produciren, dessen Stärke im Durchschnitte 18 Grad beträgt. Dieser Artikel hat folgende Hauptabsatzorte : Radomir, Kustendil und Palanka, welche dagegen Butter, Käse und Hufeisen einführen ; Wranja, welches Seile und Hufnägel bringt ; Kumanowa, Bitolia, Prilip, Maleschewo und Istib, welche ihn mit barem Gelde bezahlen.
Trotz der Nähe von Salonik, von wo die Colonialartikel, englische Baumwolle und Eisenwaaren bezogen werden, unterhält Welesa nicht unbedeutenden Verkehr mit Wien und empfängt von dort namentlich Tücher und Modeartikel.
Wir besprachen in Welesa natürlich auch unsern Plan, den Wardar bis zur Mündung der Czerna hinab und dann diesem Flusse entlang in den Kessel von Monastir einzudringen, weil derselbe noch gänzlich unbekannt ist. Aber man rieth uns allgemein, von diesem
1. Ueber die Holztiösserei auf dem Wardar s. des Verfassers Drin- und Wardar-Reise, I, S. 174.
![]()
171
Unternehmen in der gegenwärtigen Jahreszeit abzustehen. Die Gegenden, durch welche wir unsern Weg nehmen müssten, seien nämlich von dem Défilé an, aus welchem die Czerna in die Ebene von Karaferia tritt, hier gänzlich unbekannt, und dies zeige, dass sie unwegsam oder, wenn nicht öde, nur schlecht bevölkert seien ; ob wir wohl wüssten, was es heisse, in zerrissenen Gebirgsgegenden zu reisen, wenn der Schnee die schmalen Fusspfade bedecke, welche durch sie führen? jeder Schritt sei dann unsicher und daher gefährlich, und es käme vor, dass sich die kundigsten Wegweiser verirrten. Wir wussten zwar das Gewicht dieser Einwürfe zu würdigen, weil wir einmal bei einer Winterreise durch eine uns genau bekannte griechische Berggegend in sehr bedenkliche Lagen gerathen waren ; überzeugt von der Schwierigkeit des Unternehmens wurden wir erst durch die Frage, was wir machen wollten, wenn wir auf der Mitte des Weges hörten, dass derselbe die Czerna kreuze (und dass dies mehrmals der Fall sein werde, dafür spreche die Vermuthung), ob wir dann durch die Hochwasser schwimmen oder am Ufer warten wollten, bis sie sich verlaufen hätten, bedenklich gemacht. Wir gaben also mit schwerem Herzen die Czerna auf, und beeilten unsern Aufbruch von Welesa um so mehr, als die Regenfluthen der vergangenen Tage den nach Bitolia führenden Babunapass schneefrei gemacht hatten, denn wenn derselbe wieder zuschneite, so war nicht daran zu denken, mit den Wagen über denselben zu kommen, und blieb uns dann nichts übrig, als über Istib nach Salonik zu gehen.
Um so eifriger waren wir daher darauf bedacht, Erkundigungen über die unteren Wardar- und Czernagegenden einzuziehen, und hier begegnete uns die auffallende Erscheinung, dass wir damit nicht weiter Vordringen konnten, als unsere Vorgänger. Bis in die Umgegend von Kafadartschi wusste man hier Bescheid, aber weiter nicht, weder den Wardar noch die Czerna entlang, und die einzige Frucht unserer Erhebungen war die Herabdrückung der Mündungen der Czerna und Bregalnitza um drei Stunden gegen Süden, denn nach allen Angaben mündete die Czerna nicht drei Stunden, wie Kiepert angibt, sondern sechs Stunden südlich von Welesa, wodurch der barocke Bogen dieses Flusses um ein kleines Stück verkürzt wird. Auch erfuhren wir, dass Demir Kapu, zu deutsch: eisernes Thor, der Name einer Stromenge des Wardar sei. An deren nördlichem Ende liege am rechten Flussufer ein nach derselben benanntes Tschiflik, aber die von Kiepert an der Moglenitza verzeichnete Stadt Demir Kapu war sowohl hier als in Bitolia und
![]()
172
Salonik vollkommen unbekannt [1]. Nach den Aussagen der in Salonik verhörten Pferdetreiber soll der Wardar von Kafadartschi bis Demir Kapu in ebenen Gegenden fliessen und der Weg bis dahin fahrbar sein [1]. Die Erkundigungen, welche wir in Prilip und Bitolia über den Lauf der unteren Czerna vor ihrem Eintritte in die Wardar-Ebene anstellten, waren gleich erfolglos, und wir mussten daher den Schleier, welcher über ihr und der nördlichen und östlichen Nachbarschaft des Nidscheberges ruht, ungelüftet lassen.
XXVI. Babuna-Pass.
Unsere Abfahrt von Welesa erfolgte an einem Bazartage; die engen Strassen waren mit Menschen und Büffelwagen so gefüllt, dass wir uns nur mit Hilfe des Polizeichefs durchwinden konnten, und froh waren, als wir endlich aus diesem Getümmel und über die baufällige Brücke in’s Freie gelangt waren, und die Untersuchung des Firmaments einen leidlichen Tag in Aussicht stellte. Wir fuhren anfangs auf dem Südrande der kleinen Kesselebene von Welesa gegen Westen, stiegen aber bald in südlicher Richtung von demselben in das Thal der Topolka, deren Mündung in den Wardar wir auf unserem Besuche des Klosters St. Demetrius gekreuzt hatten, und fuhren ihr ebenes Rinnsal bis zu dem eine Stunde von Welesa entfernten Dorfe Orisar aufwärts ; denn bevor dieser Bach in der Richtung von Westen nach Osten die kaum 15 Minuten breite Fels kette durchbricht, welche die rechte Wand des Défilé’s von Welesa bildet, läuft er auffallender Weise von Süden nach Norden, also in entgegengesetzter Richtung mit dem Wardar.
Nachdem wir bei Orisar die Topolka gekreuzt hatten, fuhren wir den flachen Höhenrücken hinan, welcher jene Felskette am rechten Wardarufer mit der Babunakette verbindet und das Gebiet der Topolka von dem der Babuna trennt. Der letztere Bach ahmt in seinem unteren Laufe die Winduugen der Topolka, wenn auch nicht mit gleicher Schärfe, nach, fliesst wie diese durch einen senkrechten Riss jener Felskette, und ergiesst sich bei seinem Austritte eine Stunde südlich von Welesa in den Wardar [2].
1. Näheres in des Verfassers Drin- und Wardar-Reise, Cap. 29 u. folg.
2. Grisebach II, 222, welcher die Wegstrecke sehr rasch durcheilte, nimmt die Topolkamündung für die der Babuna.
![]()
173
Der Weg zog auf jenem Rücken die Wasserscheide beider Bäche in südwestlicher Richtung aufwärts und verstattete freie Aussicht über ein hügeliges Flachland, welches sich gegen Norden bis zu dem Salkowagebirge, gegen Westen bis zu der Babunakette und gegen Süden bis zu einer niedrigeren Bergreihe erstreckt, welche vermuthlich die Babuna von dem Gebiete der Czerna trennt.
Die Formen dieser Landstrecke schienen uns noch weicher zu sein, als die des Westrandes der Mustapha Owassi, welchen wir von Kaplan-Chan bis zum Wardar durchzogen hatten, und brachten uns auf die Vermuthung, dass nähere Untersuchungen jenes Flachland nicht mit dem Wardar abschliessen, sondern die von Norden nach Süden streichende Babunakette als deren Westrand bezeichnen werden. Ein Blick von der Babuna würde diese Frage entschieden haben, wurde uns aber von dem auf der Kuppe des Passes lagernden Nebel verweigert [1].
Drei Stunden von Welesa erreicht der Weg das Rinnsal der Babuna bei der Vereinigung ihrer beiden Arme. Längs des nördlichen führt, wie wir erst später erfuhren, ein bequemer Fahrweg bis zum Kamme der Babuna, und bietet nur auf seiner steilen Senkung in die Beckenebene von Prilip eine halbstündige schwierige Strecke für die Wagen. Mit dieser wegen ihrer grösseren Länge von den Reitern nicht besuchten Linie unbekannt, wählten wir zu unserem Uebergange die gewöhnliche Strasse. Wir zogen daher das Rinnsal des südlichen Babunabaches aufwärts durch ein breites, fruchtbares Thal, in welchem etwa drei Viertelstunden von jenem Chane das Dorf Iswor liegt, welches Kiepert an die Mündung der Babuna in den Wardar versetzt, und erreichten in einer weiteren Stunde den Babuna-Chan, den stattlichsten Bau dieser Art, welchen wir auf der ganzen Reise sahen. Denn sein oberstes Stockwerk ruht auf hohen, aus Quadern erbauten Bogen, welche zu den weiten Ställen führen, und Haupt- und Nebengebäude sind durch starke Umfassungsmauern und ein massives Thor wohl verwahrt. Der Bau zählt vielleicht mehr als ein Jahrhundert; schade, dass er schlecht unterhalten wird. Von ihm an verengt sich das Thal sehr allmählich, und wird etwa eine Stunde vor dem Wezir-Chan, unserem Nachtlager, zu einem ziemlich steil aufsteigenden Waldthale.
1. Grisebach sagt II, 221 von Prilip nach Welesa reisend: „Dicht jenseits des 3 Stunden von Köprili entfernten letzten Hanes erscheint zum ersten Mal nach Osten freier Horizont, so weit das Auge reicht ist keine Bergbette mehr sichtbar, sondern nur wellenförmige Flache, die Ebene von Mustapha.“
![]()
174
Der Wezir-Chan ist von seinem gegenwärtigen Besitzer Abdi Pascha, Commandirenden in Skodra, vor einigen Jahren von Grund aus frisch gebaut worden, und wird nun nach seinem Namen genannt; doch ist seine frühere Benennung noch nicht ganz verschollen. Wir fanden dort vier Ochsengespanne, zwanzig Bauern aus dem nahe gelegenen, Abdi Pascha gehörigen Dorfe Czernitza und die nöthigen Beit- und Lastpferde zum Uebergange über den Pass bereits im Hofe des Chans versammelt und vom Kavassen, welcher sie aufgeboten, überwacht. Die Bauern erhielten Brod, Käse, Zwiebeln und Wein, die Thiere Futter aus dem Chane, alle wurden über die herkömmliche Taxe bezahlt, und dennoch erforderte der Uebergang nur wenig mehr als vier Ducaten. Mit Tagesgrauen setzte sich der Zug in Bewegung, an jedem Wagen zogen zwei Ochsengespanne und das Gepäck war auf Lastthiere verladen. Wir blieben noch eine Stunde im Chane zurück, um das Verhör des Wirthes, eines besonders intelligenten Zagoriten, welcher von Kindheit an seinem Gewerbe in dieser Gegend obliegt, abzuschliessen. Der Mann begriff sogleich, was wir wollten, und lieferte, indem er mehr referirte als antwortete, so klare und erschöpfende Angaben über die Strasse und ihre Umgebung, dass wir seinen Bericht unter die besten rechnen, welche wir auf der ganzen Reise einzogen.
Der Weg vom Chane zu dem Passsattel ist anfangs nicht schlechter, als der bis zum Chane; er blieb eine holperige, mit grossen Steinen gepflasterte türkische Strasse in vernachlässigtem Zustande, aber je höher wir kamen, desto unwegsamer wurde er für die Wagen: hier hatte der ihn kreuzende Sturzbach sich in ein mehrere Fuss tiefes, mit Steinblöcken gefülltes Bett eingerissen, dort war die halbe Strasse in’s Thal hinabgeschwemmt und die noch übrige Hälfte senkte sich ihm in steiler Böschung zu, und an anderen Strecken hatte sich der Regenstrom die Strasse selbst zum Bette erkoren und zu den aufgewühlten alten Pflastersteinen grössere Felsblöcke von den Abhängen herabgeführt. Wir hörten den Zug der Wagen eine halbe Stunde, bevor wir ihn erreichten, und hielten es nicht lange in seiner Nähe aus; die Wagen wurden mehr getragen als gezogen, und dazu schrien unsere Leute, brüllten die Bulgaren und wütheten die Kavassen mit Stimme und Peitsche. Wir ritten also bis zu dem auf der Kuppe des Passes gelegenen Wachthause vor, thaten uns dort an dem Kaminfeuer und dem prächtigen Kaffee gütlich, mit der uns die Besatzung bewirthete, und verbrachten die Zeit, bis uns die Wagen erreichten, in ihrer Gesellschaft, denn der rieselnde, nasskalte Nebel verleidete den Aufenthalt im Freien.
![]()
175
Hier hörten wir, dass die Strasse sehr unsicher und unter andern erst Tags zuvor ein wohlhabender Kaufmann aus Prilip, der eine starke Geldsumme mit sich führte, eine halbe Stunde unterhalb des Wachthauses ermordet worden sei, ohne dass die Besatzung es gewahr wurde.
Als die Wagen uns erreicht hatten, meldete man, dass die eiserne Vorderachse des Wagens gebrochen sei und man sie zwar mit Stricken und Prügeln so gut als möglich unterbunden, dass aber der Herunterweg noch steiler und schwieriger sein solle, als der Aufweg. Da es uns nun überflüssig erschien, der stückweisen Zertrümmerung unserer Gefährte als unthätige Zeugen beizuwohnen, so ritten wir nach Prilip voraus, in der Erwartung, dass uns die Leute deren Rudera in ihren Hosentaschen nachtragen würden, doch kam Alles in einigen Stunden ohne weiteren Schaden nach [1].
Wie der Weg auf dem Osthange der Babuna sich bis zum Passsattel in einer Thalfalte hinaufzieht, so senkt er sich auf dem Westhange in einer ähnlichen in die Beckenebene von Prilip hinab, doch mit dem Unterschiede, dass die letztere Strecke eine Stunde lang ist, während man die acht Stunden von Welesa bis zum Passsattel beständig ansteigt. Dieser kurze Abfall zeigt, um wie viel höher die Beckenebene von Prilip über dem Wardarthale bei Welesa liegt; die Meereshöhe des Wardar bei dieser letzten Stadt beträgt 54 Fuss und Prilip ergibt nach unsern Messungen 1822 Fuss Meereshöhe. Der Höhenunterschied beider Puncte beträgt mithin zwischen 1200 bis 1300 Fuss. Am Fusse des Gebirges liegen die Ruinen eines von Räubern zerstörten Chans. Von da rechnet man zwei Stunden bis Prilip, der Weg führt durch das östliche Busenthal der Beckenebene längs der Prilipska Rjeka, welche eine halbe Stunde unterhalb des Wachthauses der Babuna entspringt.
XXVII. Prilip.
Wir stiegen in dem Hause der reichsten bulgarischen Familie der Stadt ab ; wir sagen Familie, weil sie aus fünf Brüdern bestand, welche mit ihrer alten Mutter, ihren Frauen und Kindern in ihm
1. Ueber den Babunapass führt gegenwärtig eine neue Kunststrasse, s. des Verf. Drin- und Wardar-Rcise I, S. 150, und ebendaselbst Angaben über die Schlacht im Worilla-Walde, in welcher Deutsche gegen Franzosen kämpften,
![]()
176
unter einem Dache lebten und an einem Tische assen ; es kann also nicht klein sein. Von den Brüdern waren jedoch nur zwei anwesend, die übrigen auf Reisen, denn das Haus macht bedeutende Geschäfte, namentlich in Tabak, welcher in bedeutenden Quantitäten und im Durchschnitt von guter Qualität auf der Ebene gebaut wird, und dessen Ausfuhr vorzugsweise durch seine Hände geht. Die Hauptabsatzpunkte sind Salonik und Belgrad. Ein Epigone dieser Brüder war erst kürzlich aus Wien zurückgekehrt: er sprach geläufig deutsch, und stiess tiefe Seufzer der Sehnsucht aus, sobald er der Kaiserstadt gedachte. Meublirung und das ganze Gebaren im Hause zeigte, dass man streng an der Väterweise festhielt und die Verbindung mit dem Abendlande das Familienleben noch nicht berührt hatte.
Wir bewohnten den türkisch meublirten, geräumigen Empfangssaal, dessen Fenster auf die Prilipska gingen, welche mitten durch die Stadt fliesst. Sie ist von behäbigen, mitunter stattlichen Häusern eingefasst. Diese Flussstrasse machte trotz des Regenwetters einen nicht unfreundlichen Eindruck, wurde aber durch den schmucken, neugebauten Bazar übertroffen, dessen Magazine auch an Luxuswaaren, wie gemaltem Porcellan, geschliffenen Gläsern und dergleichen, reicher waren als alle Städte, die wir bis dahin besucht hatten.
Prilip war uns schon in Skopia als die eigentliche Residenz Marko Kralj’s bezeichnet worden, und wir säumten daher auch nicht, am Tage nach unserer Ankunft die nach ihm benannte Schlossruine, Marko Kralj Grad, zu besuchen.
Dieser Grad liegt auf dem letzten in die Ebene abfallenden Felshügel der von der Babuna gegen Prilip zu in südwestlicher Richtung abzweigenden Felskette von Dreskawetz, welche den rechten Thalrand der Prilipska Rjeka bildet, und ist von dieser Kette durch eine starke Einsattlung geschieden.
Die Entfernung der Stadt von dem Fusse dieses Hügels beträgt in westlicher Richtung eine Viertelstunde und seine Höhe etwa 300 Fuss. Er hat zwei Felsgipfel, von denen der nördliche bedeutend höher ist als der südliche. Der Zugang zu der Festung lag auf der der Stadt zugewandten Ostseite des Hügels, bei einem, die Kula der Zuza des Marko Kralj genannten viereckigen Thurm, neben welchem eine auch im Sommer fliessende Quelle zu Tage kommt.
Von da gelangt man zu der zwischen den beiden Gipfeln liegenden Einsattlung, welche die Eingebornen als den Marktplatz (Zarsé) der Festung bezeichnen. Der höhere Nordgipfel, auf welchem
![]()
177
das Serail des Marko Kralj stand, scheint, den erhaltenen Spuren der Mauern nach zu urtheilen, eine vom Marktplatze gesonderte Festung gebildet zu haben. Eine auf der unteren Terrasse des Nordgipfels gelegene Ruine wird das Vorrathshaus (Ambar) des Marko Kralj und ein etwas oberhalb desselben gelegenes kleines Gewölbe die Webstube seiner Zuza genannt, nach welcher auch die auf dem westlichen kleinen Hügel gelegenen Thürme benannt werden. Was es aber mit dieser Zuza für eine Bedeutung habe, konnten uns leider unsere Führer nicht sagen, auch in der Stadt trugen wir vergebens nach derselben.
Nachdem wir eine platte und steile Felswand mit vieler Mühe erklettert, gelangten wir zu dem sogenannten Burggarten, der Capelle und der Stelle, wo der Kiosk des Marko Kralj gestanden haben soll [1]. Besonders beachtungswerth erschienen hier die äusserst rohen und unbehülflichen, aber wahrscheinlich uralten Zeichnungen von Reitern mit eingelegten Lanzen, Ochsen, Hirschen und verschiedene hieroglyphische Züge, welche gleichsam in die Wände mehrerer flacher Felsgrotten eingeätzt zu sein schienen und uns an die Steinzeichnungen erinnerten, welchen Wilkinson an vielen Orten der Herzegowina begegnete. Doch sahen wir uns vergebens nach den dort so häufigen Emblemen des Halbmondes und Sternes um.
Die ganze Festung scheint, der Gestaltung des Hügels folgend einen schmalen, von Nordostuorden nach Südwestsüden gestreckten Riemen gebildet zu haben, welcher in seiner Mitte, wo der Markt lag, am breitesten war.
Auf dem Westabhange des Festuugshügels liegen mehrere Felsengräber. Wir bemerkten namentlich an einer Stelle zwei hart an einander stossende Reihen von je sechs Gräbern, deren Oeffnungen oben breiter als unten sind oder, ihren geringen Dimensionen nach zu schliessen, zur unmittelbaren Aufnahme des Leichnams bestimmt waren. Die oberen Ränder waren zur Einlassung eines steinernen Deckels zugehauen. Unweit davon liegt ein Kindergrab.
Von hier ging es auf einem mitunter halsbrecherischen Wege über steile, platte Felswände, und zwischen barock auf einander gestapelten Felsblöcken zum südlichen Fusse des Festungsberges hinab;
1. Es ist mehr als Mythe, dass Marko Kraljevic, der beliebte Nationalheld, dessen Grossthaten die serbische Sage mit Vorliebe sich bemächtigt hat, in diesen Gegenden geherrscht habe. In letzter Zeit wurden kleine Münzen mit dessen Namen und der Bezeichnung als „König von Macedonien" aufgefunden. Sie tragen die Namen der Städte: Skoplje (Skopia), Prisrend und der altserbischen Bergstadt Novobrdo.
![]()
178
hier liegt eine Kirchenruine, welche von Marko Kralj’s Vater gebaut sein soll, und deren Bildwerke zum Theil noch gut erhalten sind. Beachtenswerth war die gute Zeichnung zweier grösseren Gestalten, Erzengel darstellend, von denen uns der Kopf des einen den Eindruck machte, als sei er die Copie eines antiken Steinwerkes.
Die Hautfarbe sämmtlicher Gestalten war mehr oder weniger ausgesprochenes Grün. Wir verzeichnen nur die Thatsache und lassen es unentschieden, ob es ein Erzeugniss der ursprünglichen gelben Fleischfarbe und der auf sie Jahrhunderte lang einwirkenden Winternässe war, oder ob durch diese die Uebermalung abgewaschen ward und die grüne Grundirung Stand hielt, denn braune Gesichtsfarbe mit einem grünlichen Tone scheint in der byzantinischen Malerei sehr beliebt gewesen zu sein. Unweit der Kirche, in der Richtung zum nahe gelegenen Dorfe Warosch, fanden wir auf einer senkrechten, platten Felswand das grosse Bild eines berittenen und unbewaffneten Heiligen, also wohl St. Georg oder St. Demetrius, auf eine dünne, viereckige Kalkschichte gemalt. Es war ziemlich wohl erhalten, obgleich es nur gegen die Nordseite vollkommen geschützt ist. In der ihm südlich gegenüber liegenden Felswand war eine Nische und mehrere Löcher, vermuthlich zur Aufnahme von Weihgeschenken eingehauen. Wir suchten vergebens nach Spuren einer früheren Ueberdachung des Zwischenraumes. Unweit davon erblickten wir in einer kleinen Felsnische das sehr verdorbene Brustbild eines Heiligen.
Das Dorf Warosch mit 70 bulgarischen Häusern liegt am südlichen Fusse des Schlossberges. Hier stand der Sage nach die alte Stadt Prilip, und dass der Ort früher von grösserer Bedeutung war, bezeugen ausser mehreren andern alten Kirchen einige byzantinische Capitale und Säulenreste und ein viereckiges Postament, welches zum Altar einer mitten im Dorfe stehenden Kirchenruine dient und eine griechische Inschrift trägt [1].
Der dem Festungshügel nördlich gegenüber liegende Felsberg der Dreskawetska Planina heisst Serenik. Von diesem beschossen, der Sage nach, die Türken die Festung, bevor sie selbe durch Sturm einnahmen. Zwei und eine halbe Stunde nördlich von Prilip nahe am Kamme liegt auf der Dreskawetska Planina das gleichnamige, erhaltene Kloster, in welchem sich der Torso einer bekleideten männlichen Bildsäule und eine altgriechische Steinschrift finden. Nordwestlich von dem Festungshügel liegt zwischen ihm
1. S. die erste Auflage.
![]()
179
und einem andern Ausläufer der Dreskawetska ein etwa eine halbe Stunde langer und breiter Busen der grossen Ebene, welcher Zategrad (jenseits des Grad) genannt wird und in welchem verschiedene Tschiflik’s liegen.
Gegen Westen erstreckt sich die reich mit Dörfern besetzte wagrechte Beckenebene von Prilip in einer Breite von vier bis fünf Stunden; ihre Länge von Süden nach Norden ist noch bedeutender, sie wurde uns zwischen sieben und acht Stunden angegeben [1]. Sie mag Grisebach wohl vorzugsweise, bei seiner genialen Schilderung der vier Ringbecken vorgeschwebt haben, welche sich an den östlichen Abfall des Skardus anlagern [2] und deren südlichstes Thessalien ist. Er fasst seine ausführliche Beschreibung derselben in der Formel zusammen, dass bei ihnen eine kreisförmige Urgebirgskette die eingeschlossene wagrechte Alluvialebene um das Vierbis Sechsfache nach allen (?) Seiten au Höhe übertreffe, und sucht deren Wiederholung auf unserem Planeten vergebens. Uns stellt kein Urtheil über diese These zu, und wir müssen es daher späteren Forschungen überlassen, ob sie diese jedenfalls geniale Auffassung bestätigen, oder zur Annahme einer östlichen Parallelkette des Skardus und Pindus führen werden, welche von dem Nordende des Karschiak bei Skopia über die Babunakette den Nidsche (Bora), Doxa (Bermius), Piems. Olymp, Ossa und Pelion streichend, in den nördlichen Sporaden zu Ende geht und nur von drei Flüssen, dem Erigon, Haliakmon und Peneus, durchbrochen wird. Diese letzte Hypothese findet sich bereits auf der kleinen von Kiepert verbesserten weilandischen Karte des osmanischen Europa von 1849 angedeutet. Vielleicht lassen sich auch beide Ansichten verbinden [3].
Dem Markograd westlich gegenüber hatten wir jedoch keine von den äusseren Ringwänden des grossen Beckens, sondern eine Zwischenwand vor uns, deren Kamm in seinen höchsten Theilen, wenn uns diese durch die tiefgehenden Wolken nicht verdeckt waren, die Becken schwerlich um 1000 Fuss überragte. Als wir uns nach den auf derselben gelegenen Ortschaften erkundigten,
1. Rechnet man den an zwei Stunden langen Thalbusen von Prilip zu ihrer Breite, so ist die Ebene so ziemlich ebenso lang als breit.
2. II, S. 123, 29.
3. Merkwürdiger Weise culminiren die sehr verschiedenen Meereshöhen jener Ringbecken in dem vorliegenden von Prilip und Bitolia (17—1800 Fuss), und findet sich auf gleicher Breite die einzige durch die Pinduskette laufende Querspalte (Pass von Zangon), durch welche der Dewolfluss dem adriatischen Meere zuläuft,
![]()
180
nannte man uns vor Allem gerade dem Grad gegenüber Kruschewo, Stadt mit 2000 bis 3000 Häusern, in einer Felsschlucht, sechs Stunden von Prilip gelegen. Da der Name Krschewo ausgesprochen wird, und Kritschowo fast gleichklingend Krtschowo lautet, so glaubten wir anfangs, dass man uns Kritschowo zeige, und wunderten uns über dessen unerwartete Nähe, bis wir die Verschiedenheit beider Orte erfuhren, welche auf kürzestem Wege sieben Stunden aus einander liegen. Diese von keiner uns bekannten Karte aufgeführte Stadt erregte natürlich in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit. Wir erkundigten uns nach ihr so genau als möglich, da die zwischenliegenden Sümpfe in dieser Jahreszeit zu grosse Umwege erfordert hätten, um sie zu besuchen, und brachten über dieselbe ungefähr folgende Data in Erfahrung.
Von der Ebene führt der Weg zur Stadt etwa eine Stunde lang durch eine von Westen nach Osten streichende, ziemlich jähe ansteigende Felsschlucht, welche sich zu einem kleinen Becken erweitert. In diesem und an dessen Wänden liegt die Stadt, kaum eine Viertelstunde vom Kamme des Gebirges entfernt, welches mit Buchenwald bestanden ist. Bei der Stadt liegt eine alte, allmählich verfallende Festung.
Ihre Häuserzahl ermässigte der Stadtvorstand (Chodscha Baschi) auf 1400 Häuser. Sie hat 13 Pfarrkirchen, von denen die grösste, dem St. Nicolaos geweihte, ein stattlicher Bau sein soll, der im Jahre 1832 in den Zeiten des „grossen Sadrasem's“ Redschid Pascha errichtet wurde; ferner 32 Chane, 10 Schmieden, die Hufeisen und Nägel ans Samakowa- und Salonik (englischem) Eisen schmieden, 8 Talgsiedereien, welche jährlich an 30.000 Schafe und Ziegen verbrauchen, von denen nur die besten Stücke als Fleisch verkauft, die übrigen Theile aber nebst Füssen und Kopf zu Talg versotten werden. Das jährliche Erzeugniss wird auf 1000 Lasten Talg geschätzt und nach Constantinopel, Salonik, Skopia und Bitolia geführt.
Die drei Markttage (Bazar), Montag, Donnerstag und Sonnabend, werden von der Bevölkerung der Umgegend zahlreich besucht. Die grössere und überwiegend reichere Hälfte der Einwohner sind Wlachen, die kleinere Bulgaren, wozu noch einige christliche albanesische Familien kommen, denn Muhammedaner wohnen dort nicht. Da die Stadtgemeinde in der Ebene keinen Fuss breit Landes besitzt, so nährt sich die Bevölkerung mit Ausnahme der Wanderschäfer nur von städtischen Gewerben, welche sie grösstentheils in der Fremde ausüben. Die Wlachen sind grösstentheils Kaufleute, Goldschmiede, Schneider, einige Chandschi’s und Fleischer, die Bulgaren und wenigen Albanesen Häuserbauer,
![]()
181
d. h. Zimmerleute, Tischler und Maurer zugleich, Schneider und Gärtner. Die Frauen stricken grobe Wollstrümpfe zur Ausfuhr.
Ueber die Geschichte dieser Stadt machte der Vorsteher folgende Angaben. Vor 120 Jahren stand hier nur eine armselige Meierei, welche mit einem Paar Ochsen die Felder des Kessels bestellte, und dabei stand eine kleine Kirche. Dass der Ort aber in alten Zeiten bewohnt gewesen sei, das beweist die erwähnte alte Festung und der Gedanke, denselben von neuem städtisch anzusiedeln. Mit dieser Ansiedlung aber verhielt es sich also:
Um jene Zeit wurden die wallachischen Bewohner von Nikoliza oder Nikopolis in Albanien von ihren albanesischen Nachbarn aus ihrer Heimat vertrieben, wie dies auch später denen von Moschopolis geschah, welches vor Zeiten in solcher Blüthe stand, dass seine gelehrte Schule weit und breit berühmt war und in seiner Druckerei eine Anzahl Werke gedruckt wurden.
Ein Theil der vertriebenen Nikolizaner kam nach Bitolia und fand dort bei dem damaligen Erb-Pascha Schutz. An irische Bergluft gewohnt, konnten sie das sumpfige Clima der Stadt nicht vertragen. Sie klagten dem Pascha ihr Leid, und dieser wies sie an, sich die Oertlichkeit von Kruschewo zu betrachten oder, wenn sie ihnen genehm wäre, sich dort anzubauen. Sie folgten dieser Weisung und bildeten den ersten Kern der Stadt, welcher durch andere wlachische Flüchtlinge, namentlich aus Opara und Bythakukje in Albanien, Zuwachs erhielt. Unter diesen befand sich auch ein Stamm wlachischer Wanderhirten [1], welche sich noch durch ihre Tracht von den übrigen Städtern auszeichnen, es aber zu grossem Reichthum gebracht haben und zu der städtischen Aristokratie gehören, welche sich je nach dem früheren Heimatsorte ihrer Mitglieder in verschiedene Partien gliedert. Von den Kruschewaner Kaufleuten haben es mehrere zu grossem Reichthum gebracht. Sie finden sich fast in allen Handelsplätzen der Levante, und selbst in Wien sind sechs Krnschewaner Handelshäuser.
1. Diese Wauderhirten sind auf der Südosthalbinsel sehr zahlreich, und meist wlachischen Stammes; sie gehen im Winter an die Meeresküsten Macedonien’s, Thessalien’s und des griechischen Festlandes und im Sommer in den Pindus und Scardus. Sie sind entweder volle Nomaden und wandern Jahr aus Jahr ein mit Weib und Kind, oder sie haben in irgend einer Gebirgsgegend Häuser, in denen ein Theil der Familie mit den kleinen Kindern und Greisen wohnt. Die Schafschur halten sie, je nach den Wollpreisen, in Skodra oder Salonik, ihren Absatzorten, entweder in den Sommer- oder Winterquartieren.
![]()
182
Auch das bulgarische Element zerfällt in zwei Classen, nämlich in Altbürger, welche sich Miakades nennen, und aus der Gegend von Galischnik und Lazaropula in Dibre siper zugewandert, hier Häuserbauer geworden sind, während sie als Schäfer kamen, und in die aus der Nachbarschaft zugelaufene Plebs, welche nicht wandert, sondern sich von der Stadtarbeit nährt. Dass in der europäischen Türkei noch manche Landstrecke undurchforscht ist, das weiss jeder Leser, der einmal einen Blick auf die grosse Kiepert’sche Karte geworfen hat, dass sich aber auch eine in der Nähe einer Hauptstrasse, und fast vor den Thoren der Civil- und Militärhauptstadt von Rumelien gelegene Stadt von wenigstens 7000 Einwohnern bis dahin der Kunde der Wissenschaft entziehen konnte, das war uns im höchsten Grade überraschend.
Der Kessel von Kruschewo entladet sein Quell- und Regenwasser durch die zu ihm führende Schlucht in die etwa zwei Stunden von der Stadt in der Mitte der Ebene von Norden nach Süden fliessende Blato, welche weiter nördlich in derselben Kette, auf welcher Kruschewo liegt, ihre Quellen hat, und vorher die den Nordwesten der Ebene entwässernde Ribnitza und etwa drei Viertelstunden südlich von der Mündung des Kruschewowassers die Prilipska Rjeka aufnimmt.
Zur Rechten und Linken der Kruschewoschlucht liegen am Rande der Ebene zwei albanesische Dörfer, Aladschani, von den Wlachen Agdentsche genannt, und Werbowska. Als wir uns bei dem Vorsteher nach den nachbarlichen Verhältnissen erkundigten, ergriff er mit den drei ersten Fingern seiner rechten Hand den Rand seines Oberkleides bei der Brust und rüttelte es, als ob er davon den Staub abschütteln wollte (ἐτιναξε τὸν jακά του), und als wir diese symbolische Antwort nicht bemerken wollten und weiter fragten, sagte er: Fragt nicht, schaudre Sonne! (μὴν ἐρωτᾶτε, φρῖξον ἥλιε!) Auf weiteres Drängen erfuhren wir endlich, dass diese Nachbarn von Kruschewo sich durch prononcirten Appetit nach wohlfeilem Schaf- und Ziegenfleisch auszeichneten, und es vorzögen, dieses Bedürfniss in bequemer Nähe zu befriedigen, dass die hieraus entstehenden ConHicte mitunter zu blutigen Köpfen führten, welche in der Regel die Kruschewaner davon trügen, und dass die getrübten nachbarlichen Beziehungen die letzteren veranlassten, auf Reisen ihre Rückkehr so einzurichten, dass sie noch vor Sonnenuntergang fiele.
Wenn der Vorsteher bei der Schilderung dieser Verhältnisse vielleicht etwas zu grelle Farben an wandte, so berechtigt sie doch zu der Annahme, dass dieselben keineswegs gemüthlich sind, und
![]()
183
hiemit stimmen auch alle andern Nachweise, welche wir über das Verhältniss zwischen Albanesen und Bulgaren zu sammeln Gelegenheit hatten. Unter allen Volkselementen der Halbinsel möchte sich überhaupt das albanesische am schwersten mit der modernen Staatsordnung befreunden. Wer sich die menschlichen Urzustände in dem Lichte der gessnerischen Idyllen denkt, der gehe nach Albanien, und lerne hier, wie sich das menschliche Herz nur in dem Boden der Ordnung und Bildung zu entwickeln vermag, und wie es, wo dieser fehlt, entweder im Keime vertrocknet, oder jenen Hungerpflanzen gleicht, welche sich ans humuslosen Felsenspalten emporkümmern.
Uebrigens ist das albanesische Element in dem Bezirke von Prilip nur schwach vertreten. Derselbe zählt im Ganzen 160 Dörfer, unter diesen gibt es nur 18 muhammedanische, von welchen 12 von Albanesen und 6 zum Islam übergetretenen Bulgaren bewohnt sind.
Der Bezirk erstreckt sich über das Ringbecken und die beiden Abhänge der Babunakette bis gegen die untere Czerna, denn Trnowo (türkisch Drenowo), welches eine halbe Stunde vom linken Ufer derselben abliegt, gehört noch zu Prilip, und hier grenzt es mit dem Bezirke von Tikwesch.
Der östlich von Prilip streichende Theil der Babunakette wird dort nach dem an deren Fusse gelegenen Dorfe Selsetska Planina genannt, denn die Ausdehnung des Namens Babuna über die ganze Kette ist nur ein wissenschaftlicher Behelf. Auf dem jenseitigen Abhang liegt die Gebirgslandschaft Mariofze. Sie zählt 19 bulgarische Dörfer und wird grösstentheils von wandernden Holzsägern bewohnt, welche sich auf den Bau einfacher Schneidemühlen verstehen, deren Construction mit der amerikanischen Bockmühle grosse Aehnlichkeit hat. Ihr grösstes Dorf Dunje liegt mit 100 Häusern vier Stunden östlich von Prilip, das zweitgrösste Witolize mit 90 Häusern sechs Stunden südöstlich von der Stadt [1].
XXVIII. Bitolia.
Die Becken von Prilip und Bitolia werden durch einen niederen Höhenzug geschieden, welcher sich von der Babunakette gegen Westen abzweigt,
1. In des Verf. Reise durch das Drin- und Wardargebiet, Abth. I, S. 146 finden sich nähere Angaben über diese Landschaft.
![]()
184
und diese Kette mit den Bergen von Kruschewo verbindet. Die Blato hat sich eine schmale Kinne durch denselben erzwungen und führt in ihr die Wasser des Prilipbeckens der Czerna zu. Diese haben aber so geringen Fall, dass sie sich vor dem Eingänge des Défilé’s längs den Rinnsalen des Blato und der Prilipska zu einem Sumpfsee aufstauen, welcher dem ersteren Bache seinen Namen (Blato, Sumpf) gegeben hat [1]. Der Lauf dieser Bäche zeigt, dass die Beckensohle von Prilip im wesentlichen von Norden nach Süden geneigt ist.
Der directe Weg von Prilip nach Bitolia, welcher acht Stunden lang ist, führt indessen nicht durch das Défilé der Blato, sondern südlich von demselben über den genannten Höhenrücken zu dem Dorfe Noschpol, welches halb weg zwischen beiden Städten liegt. Wir mussten uns der Winterwasser wegen noch näher an der Babunakette halten , und den über deren lehngeböschten Wurzeln führenden neunstündigen Winterweg einschlagen. Doch wurde uns die Fernsicht durch die fast zu der Ebene herabreichenden Wolken verkümmert. Wir wissen daher über die nördliche Scheidewand des Beckens von Prilip und des Treskagebietes nur die auf verschiedene Data gestützte Vermuthung zu äussern, dass sie eine steile und ununterbrochene Gebirgskette sein dürfte, welche wahrscheinlich bis zur Babunakette reicht. Denn der Bachfächer, welcher sich bei Kritschowo zu einem Wasser vereinigt, gehört nicht, wie Kiepert vermuthet, zu dem Gebiete der Blato, sondern ist, wie schon Grisebach [2] berichtet, die Quelle der sich drei Stunden oberhalb Skopia in den Wardar ergiessenden Treska. Die hierüber eingezogenen näheren Angaben finden sich in den topographischen Notizen der ersten Ausgabe unter der Rubrik dieses Flusses.
Bald nach dem Austritte aus dem Défilé mündet die Blato in die Czerna, welche aus einem breiten, von Westen nach Osten streichenden Thale kommt, und nach Aufnahme der Blato sich gegen Süden wendend, in dieser Richtung die Beckenebene von Bitolia bis zur Breite dieser Stadt durchfliesst.
Die Ebene mag hier zwischen zwei und dritthalb Stunden breit sein, und die angeschwollene Czerna bildete in ihr einen mächtigen See. Wir übernachteten in dem bereits in der sumpfigen Niederung gelegenen Dorfe Dedebalze und fuhren am andern Morgen nach Nowak.
1. Man nannte uns zwar auch den oberen Theil des Baches mit diesem Namen, wir vermuthen jedoch, dass eine nähere Untersuchung denselben auf den Abfluss des Sumpfes beschränken wird.
2. I, 8. 224.
![]()
185
Dieses Dorf liegt zwei Stunden östlich von Bitolia, an dem Ende des Steindammes , welcher den Ueberschwemmungsrayon der Czerna quer durchschneidet und genau eine Stunde lang ist. Der Wasserspiegel stand dem Niveau dieser holperigen Pflasterstrasse beinahe gleich und zog durch die zahlreichen mit Holz bedeckten Durchlässe so gemächlich südwärts, dass man an manchen Stellen die Strömung kaum gewahr wurde. Diesen stauenden Wassern verdankt die Ebene das endemische Fieber, welches periodisch den Charakter einer Epidemie annimmt. Nach der Aussage von Sachverständigen wäre es jedoch möglich, den Wassern durch Erweiterung und Vertiefung des Czernabettes in dein Défilé zwischen dem Nidsché und dem Südende der Babunakette, in welches der Fluss aus der Ebene tritt, einen rascheren Abzug zu geben , und wir hörten, dass diese Arbeit in Angriff genommen werden solle, sobald die neue Fahrstrasse nach Wodena vollendet sei.
Bitolia hebt sich durch seine, wenn auch nur wenig über die Beckensohle erhöhte Lage recht stattlich von seinem Hintergründe ab, und bietet mit seinen 13 Minarets und reichem Baumwerke, von herrlichen Bergumrissen überragt, einen malerischen Anblick. Es liegt an der Mündung eines kleinen Busens der Ebene, welcher sich zu einem Thale zuspitzt: dieses trennt den südwestlich von der Stadt unmittelbar in die Ebene abfallenden mächtigen Peristeriberg [1] von der weit niedrigeren Kette, welche die Beckenwand gegen Norden fortsetzt und etwas gegen die Ebene vorspringt. Nach der Scharkette im Norden von Skopia möchten wir unter allen Gebirgen, die wir auf dieser Heise sahen, dem zweigipfligen, steil aufsteigenden Peristeri und der ganzen Kette, deren nördlichen Abschluss er bildet, die Palme der Schönheit zuerkennen. Indessen ist nichts wandelbarer als eine Bergansicht; was gestern entzückte, erscheint heute bei schlechtem Lichte trivial.
Vom Ende des Dammes liegt Bitolia noch eine Stunde entfernt. Wir betraten die Stadt mit geringen Erwartungen, denn Boué [2] schildert sie als winkelig, schmutzig und zerfallen. Sie hat aber seit einiger Zeit einen grossen Aufschwung genommen. Schon der Eingang macht durch die mächtige Kaserne und die übrigen sich um dieselbe gruppirenden weitläufigen Militärbauten, welche sämmtlich in dem besten Stand erhalten werden, einen ansprechenden Eindruck, und dieser wird durch den koketten Kiosk erhöht,
1. Nach Grisebach II, 187: 7237 Fuss hoch.
2. Itinéraires I, 259.
![]()
186
welchen Abdi Pascha erbaute, um den Officieren der Garnison als Kaffeehaus zu dienen. An denselben reihen sich mehrere andere, kaum minder brillante Neubauten, welche den Uebergang zu der breiten geraden Hauptstrasse bilden, in der das k. k. Consulatsgebäude liegt. Die gemüthlichen Tage, welche wir in demselben verlebten, bilden unsere schönste Reiseerinnerung, und College Miksche möge hier die Wiederholung unseres Dankes für die liebenswürdige, aufopfernde Gastfreundschaft genehmigen, welche er an uns übte. In der Fortsetzung dieser Strasse findet sich ein von der hiesigen Lazzaristenmission erbautes grosses Häuserquadrat, deren Miethe der Anstalt eine erkleckliche Summe einbringt. In seiner Nähe beginnen freilich die Strassen enge und winkelig zu werden, doch fanden wir sie überall, gleich dem ausgedehnten und mit allen europäischen Luxuswaaren versehenen Bazar, sehr rein gehalten.
Der schönste Theil der Stadt liegt jedoch gegen ihr Westende zu beiden Seiten des Dragorbaches, welcher in gemauertem Bette mitten durch die Stadt fliesst. Längs der beiden mit eleganten Geländern versehenen Quais zieht sich eine lange Reihe grosser neuer Häuser, in welchen die zahlreichen Militärpascha’s und obersten Militär- und Civilbeamten wohnen. Der Baustyl dieser Häuser ist ein eigenthümliches Gemisch von Orientalischem und Occidentalischem, welches mitunter einen graziösen Eindruck macht, und die Ausschmückung der Façaden mit lebhaften Farben verleiht ihnen, wenn diese nicht zu bunt gewählt sind, ein recht kokettes Aussehen. Aber auch abgesehen von diesem Viertel, fanden wir in den übrigen Theilen der Stadt mehr neue Häuser und aufgeputzte Façaden, als in allen übrigen Städten, die wir bis dahin durchwandert hatten, und im Vergleich zu welchen Bitolia ganz den Eindruck einer Residenz macht.
Was diesen Namen der Stadt betrifft, so ist er der im Lande geläufigste, Monastir aber der türkische Name, Toli Monastir endlich, welchem wir zum ersten Male bei Hadschi Khalfa begegneten, scheint eine Verkürzung von Bitolia Monastir zu sein, und diese Zusammensetzung vermuthlich zwei gleichbedeutende Wörter zu enthalten, da der Name Bitolia wohl am plausibelsten von dem slavischen obitavati, habitare, wohnen [1] abgeleitet wird, und sich dann als die slavische Uebersetzung von Monastir zeigt.
1. Wir verdanken diese Ableitung dem französischen Vice-Consul in Monastir, Herrn Grimbault. Wir möchten sie der in den albanesischen Studien I, S. 272 Nr. 224 versuchten, von dem albanesischen wittolja, Taube, vorziehen, obgleich sie sich dem Bergnamen Peristeri, griechisch Taube, und durch diesen der ersten Silbe in Pelagonia anreihen lässt.
![]()
187
Das Kloster, dem die Stadt diesen Namen verdanken dürfte, ist das eine kleine Stunde südlich von derselben auf dem westlichen Beckenrande gelegene alte Kloster von Bukowa, zu dessen Kirchweihfeste die Bevölkerung des Beckens und seiner Nachbarschaft herbeiströmt.
Ueber die Einwohnerzahl der Stadt konnten wir an Ort und Stelle keine neueren Angaben auftreiben, und sind daher an diejenigen verwiesen, welche Dr. Müller [1] für das Jahr 1838 angibt, wonach die Stadt im März jenes Jahres ohne die Garnison 2400 Osmanli, 5800 muhammedanische Bulgaren und 8000 muhammedanische Albanesen, sonach mit Ausschluss der zwei Garnisonsbataillone 17,000 Bekenner des Islams bewohnten, wozu nach einer unverbürgten Berechnung noch 5000 Muhammedanerinnen zu zählen wären. Die christliche Bevölkerung bestand damals aus 9000 griechisch-gläubigen Bulgaren und 4500 Griechen beiderlei Geschlechts, 1200 katholischen Albanesen und 700 Zinzaren (Wlachen), mithin zwischen 14,000 bis 15,000 Seelen. Endlich wohnten daselbst 1400 Juden und 2000 bis 2200 Zigeuner, wonach die gesammte Einwohnerzahl sich auf 33,000 bis 34,000 Seelen belief. Allen Anzeichen nach dürfte sich jedoch die Bevölkerung der Stadt seitdem um mehrere Tausend Seelen vermehrt haben.
Wir erfuhren bei den beiden hier residirenden grossherrlichen Würdenträgern die freundlichste Aufnahme. Abdul Kerim Pascha, der Rumeli Walesi oder Civilgouverneur, ein Vierziger von fast colossalen Körperformen, spricht geläufig deutsch, denn er brachte in seiner Jugend sieben Jahre in Wien zu und gedenkt noch gerne der Kaiserstadt und ihrer Bewohner, mit besonderer Liebe aber des Feldzeugmeisters Baron Hauslab, dessen Schüler er gewesen. Dass er dessen Lehren nicht vergessen, davon gab er dadurch den Beweis, dass er uns in einer unserer Unterredungen das Verhältniss der Gebiete des Dragorbaches und der Schemnitza, deren Schilderung bei Griesebach und Boué nicht zu den von uns erhobenen Angaben klappen wollte, secundum artem auseinandersetzte, und den Fehler, welchen Kiepert jener Schilderung zu Folge begangen, mit den Worten bezeichnete:
„Kiepert hat das Quellgebiet der Schemnitza dem Dragor zugewiesen, die Quellen des letzteren entspringen viel näher bei Monastir, in den Falten der nördlichen Böschung des Peristeri,
1. Albanien, Rumelien und die österreichische montenegrinische Grenze. Prag 1844, S. 83.
![]()
188
aber der Fehler erklärt sich, weil die Wasserscheide zwischen beiden Bächen wenig markirt ist u. s. w.“
Abdul Kerim Pascha steht in dem Range eines Muschir. Dieser Titel soll wörtlich die Bedeutung „Rath des Herrschers“ haben, und kommt den grossherrlichen Ministern zu, er ist aber auch ein militärischer Grad, welcher über dem des Divisionsgenerals (Ferik) steht, und den Commandirenden von Armeecorps gegeben wird. Der administrative Titel dieses Functionärs, Rumeli Walesi, in’s Deutsche übersetzt, lautet: „Statthalter des Römerlandes“, und schreibt sich aus den Zeiten her, in welchen die europäische Türkei in zwei Statthalterschaften, Rumeli und Bosna, zerfiel, und der ersteren sogar der Sandschak von Morea unterstand. Heut zu Tage ist dessen Gebiet weit. beschränkter, und figurirt es in dem grossherrlichen Staatskalender als eilftes Provinzialgouvernement unter dem Namen Ejalet von Rumeli. Dasselbe zerfällt gegenwärtig in die vier Kreise oder Liva’s von Uschkudra (Skodra), Ochrida, Manastir (Bitolia) und Kesriè (Kastoria), hat also auch den früheren Sitz des Begier Beg von Rumeli, Sophia, verloren. Der Kreis von Ochrida begreift das ganze mittlere Albanien und reicht daher bis zur Küste des adriatischen Meeres. Wir begegnen mithin der alten römischen Provinzialeintheilung, welche diesen Landestheil in der Regel zur Provinz Macedonia schlug [1]. Die Stellung des Liva von Skodra ist schwankend, indem dieser Kreis mitunter auch von einem der Pforte direct unterstehenden Pascha verwaltet wird, wie dies während unserer Anwesenheit im Jahre 1850 der Fall war, und wenn wir nicht irren, auch gegenwärtig der Fall ist. Auch das ganze Ejalet von Uskjub, dessen Regierungssitz Prisrend ist, untersteht zu Zeiten der Competenz des Rumeli Walesi, wie denn überhaupt die Eintheilung der Ejalet’s und Liva’s mannigfachen Schwankungen unterliegt, welche die, meist auf natürlichen Grenzen basirte Eintheilung der Kaza’s oder Mudirlik’s unseres Wissens weniger erfahren.
Bitolia ist auch der Sitz des General-Commandos des Armeecorps von Rumelien, welches sich mit Ausnahme des Militärdistrictes des Armeecorps von Constantinopel [2] über die ganze europäische Türkei erstreckt. Der gegenwärtige Commandirende ist der Muschir Ismael Pascha, dessen Namen dem Leser von dem letzten russischen
1. Albanesische Studien I, S. 217 sp.
2. Die türkische Armee ist bekanntlich in 6 Armeecorps eingetheilt: 1. Garde, 2. das von Constantinopel, 3. Rumelien, 4. Anatolien. 5. Arabien, 6. Irak (Mesopotanien) zu je 6 Regimenter Infanterie, 4 Cavallerie und 1 Artillerie mit einem Effectiv von 20,000 Mann und 12 Batterien.
![]()
189
Kriege her geläufig sein wird, in welchem er an der Donau commandirte und später einen Theil der Wallachei besetzte, bei welcher Gelegenheit er sich das Grosskreuz des Leopold-Ordens verdiente. Leider sprach derselbe nur türkisch, und wir wurden dadurch in dem Genüsse seiner heiteren und geistreichen Unterhaltung verkürzt, so vortrefflich auch dieselbe von seinem Generalstabschef Major Mechmet Effendi vermittelt wurde, welchem wir auch für alle Aufmerksamkeiten verbunden sind, mit welchen er uns während unseres ganzen Aufenthaltes überhäufte.
Auf unseren Wunsch, die verschiedenen Militäretablissements der Stadt zu besuchen, schickte uns der Muschir seinen Wagen und beorderte Mechmet Effendi, uns dahin zu begleiten. Sämmtliche Etablissements liegen, wie bereits erwähnt, auf einem grossen ebenen Platze, am Südende der Stadt. Wir besuchten zuerst die grosse Caserne, ein ungeheures Quadrat, welches 8000 Mann fasst. Sie besteht aus einem Erdgeschosse und einem oberen Stocke. Im Erdgeschosse der Nebenflügel sind die Ställe. Nachdem wir bei dem Commandanten, der uns empfangen hatte, den unvermeidlichen Kaffee genommen hatten, führte er uns durch alle Räume des Baues. Die fast in allen türkischen Militäranstalten herrschende Sauberkeit war uns nichts Neues, was wir aber hier sowohl als in den übrigen Anstalten sahen, übertraf unsere Erwartungen. Sie beschränkte sich nicht blos auf die Zimmerboden der wohlgelüfteten Säle, auch Gänge, Treppen und Fenster u. s. w. waren blank, an den schneeweissen Wänden prangten die blitzenden Waffen, und in der Küche hätte eine Holländerin schwerlich etwas zu tadeln gefunden. Auch in den Ställen herrschte Ordnung und Reinlichkeit, und die gut gehaltenen Pferde, welche darin standen, waren höher und kräftiger als nach dem Landesschlag zu erwarten war. Wir vergassen jedoch, uns nach ihrer Heimath zu erkundigen.
Von da ging es zu dem Arsenal, einem ähnlichen, nur kleineren Vierecke. Die hier herrschende Ordnung, Sauberkeit und weise Raumbenutzung erinnerten an ein Kriegsschiff. Der grosse Reichthum der hier massenhaft aufgehäuften Militärrequisiten und ihre Qualität erregte die Bewunderung des Major Zach, welcher uns auf Vieles aufmerksam machte wofür eben nur der Soldat Augen hat. Bei dem Zeughause liegen die noch im Entstehen begriffenen Werkstätten, in welchen alle nöthigen Gewerbe vertreten sind und besonders tüchtige Sattlerarbeit geliefert wird.
Etwas näher an der Stadt steht das Militärhospital, gleichfalls ein ungeheures Viereck, jedoch mit dem Unterschied,
![]()
190
dass es nur aus einem Erdgeschosse besteht und der innere Kaum einen sorgfältig gehaltenen Garten bildet, in dessen Mitte eine Fontaine springt. Ali Bey, der Generalstabsarzt der Armee, welcher seine Studien in Paris gemacht hat, zeigte uns seine in drei grossen Kisten befindliche Sammlung chirurgischer Instrumente, die reichste, welche wir je gesehen hatten, und führte uns dann durch sämmtliche Räume seiner Anstalt, welche in keiner Beziehung den Vergleich mit den besten europäischen Hospitälern zu scheuen braucht. Wir konnten in den Krankensälen keine Spur des vielen Spitälern eigenthümlichen Geruches entdecken, und erfuhren, dass auf die Lüftung der Räume die grösste Aufmerksamkeit verwandt werde. Der Krankenstand war sehr gering, und Ali Bey meinte, das Clima der Stadt sei überhaupt besser als sein Ruf. In dem Hospitale befindet sich zugleich das Generaldepôt für sämmtliche Hospitalrequisiten des Armeecorps, auf dessen Reichhaltigkeit Ali Bey eben so stolz zu sein berechtigt ist, wie der Commandant des Zeughauses.
Zum Schlüsse besuchten wir das in der Nähe des Hospitals gelegene Cadettenhaus, ein elegantes, aus Erdgeschoss und einem Stocke bestehendes Gebäude. Wir fanden die zwei oberen Classen im Zeichensaale beschäftigt, die beiden unteren in einem anderen Saale mit unterschlagenen Beinen auf einem Teppich im Kreise um einen Chodscha geordnet, welcher ihnen Religionsunterricht ertheilte. Die Anstalt ist nach europäischem Muster eingerichtet, die Schüler zerfallen in Interne und Externe. Die Schlafsäle sind mit englischen Eisenbetten versehen, und jeder Interne hat eine eigene elegante Commode. Leider ist uns nebst anderen Detailnotizen die über die Schülerzahl der Anstalt abhanden gekommen; wenn wir uns aber recht erinnern, so beträgt sie zwischen 60 und 70. Küche und Speisesaal befinden sich in dem Erdgeschosse, auch hier herrschte musterhafte Reinlichkeit.
Indem wir die Schilderung dieser Besuche überlasen, kam uns der Gedanke, dass eine ausdrückliche Verwahrung gegen den Verdacht jeder Schönfärberei hier am Platze sein dürfte ; wir berichten hier so gut wie überall nur Das, was wir gesehen haben.
Wir benutzten unseren neuntägigen Aufenthalt in Bitolia zur Aufarbeitung der Rückstände, möglichster Beförderung unserer Karte und Einzeichung topographischer Notizen über das noch wenig bekannte Czernagebiet, fanden aber hier dieselbe Erscheinung wie in Welesa und Prilip, dass ihr Lauf nur bis zu dem früher erwähnten Défilé, durch welches sie die Ebene verlässt, bekannt war, und man nur bis zu dem letzten am Eingang vor diesem Défilé gelegenen Dorfe Skotschiwir Bescheid wusste.
![]()
191
Leider wurden dessen Bewohner durch das andauernde schlechte Wetter an dem Besuche des Bazars der Stadt verhindert, und es gelang uns daher nicht, eines einzigen Skotschiwiraners habhaft zu werden. Dies bestätigte uns in der Vermuthung, dass die alte Stadt Stobi, in welcher nach der Peutinger’schen Tafel vier römische Hauptstrassen zusammenliefen, nicht in einer Gegend liegen konnte, welche heut zu Tage eine in der nächsten Nachbarschaft unbekannte Einöde ist, denn die Römerstrassen folgten eben so gut wie die türkischen dem Fingerzeige der Natur, und daher folgen nach unseren Untersuchungen die gegenwärtigen Strassen überall der alten Spur. Eine nähere Prüfung der Peutinger’schen Tafel, über welche unten Näheres, zeigte, dass dies richtig war, denn sie versetzt Stobi an die Mündung der Czema in den Wardar, wenn diese nicht drei Stunden, wie Kiepert angiebt, sondern, wie man uns in Welesa sagte, sechs Stunden südlich von dieser Stadt liegt.
Bevor wir Bitolia verliessen, gaben uns die beiden Muschile, welche unter sich auf dem freundschaftlichsten Fusse stehen, ein glänzendes Abschiedsdiner, zu welchem alle Commandanten und Chefs der Garnison geladen waren, und bei demselben hatte Ismael Pascha die Aufmerksamkeit, den ersten Toast auf das Wohl der erlauchten Körperschaft auszubringen, welche uns zur Förderung der Wissenschaft in diese Gegenden gesandt habe.
XXIX. Von Bitolia bis Wodena.
Man rechnet von Bitolia bis Salonik 32 türkische Stunden. Wodena soll genau halbwegs liegen; wir dachten daher dasselbe in zwei Tagraärschen von Bitolia aus erreichen zu können, da man uns dort viel von der neuen Fahrstrasse erzählt hatte, welche bis nach Salonik führe. Wir fanden nun dieselbe allerdings die ersten zwei Stunden in recht gutem Zustande, denn obwohl der Strassenkörper nur aus Sand bestand, so hatte er doch dem anhaltenden Regenwetter Widerstand geleistet. Weiterhin aber war die Strasse zwar gut tracirt und mit Gräben flankirt, aber es fehlte noch an jeder Beschotterung und jeder Ueberbrückung der Durchlässe, so dass die Pferde lange Strecken hindurch bei jedem Schritte bis zum Knie in den zähen Koth sanken und die Passage mehrerer Durchlassstellen nicht nur schwierig, sondern gefährlich war, während die vielen
![]()
192
Bäche, welche wir kreuzen mussten, weil sie von der Suchakette in westöstlicher Richtung der Czerna zuliefen, selbst da, wo sie noch nicht überbrückt waren, keine Schwierigkeiten darboten. Die Bäche Dragor und Schemnitza verfolgen in dem nördlichen Theile der Ebene die gleiche Richtung, und diese selbst endet in ein vo:i Westen nach Osten laufendes weites Thal. Dies zeigt, dass die Ebene von Bitolia sich von ihrem westlichen Thalrande, d. h. dem Peristeri und seiner nördlichen und südlichen Fortsetzung dem östlichen Rande oder der Babunakette zuneige. Auch ergaben unsere Erkundigungen, dass das Czernabett, oder vielmehr der Sumpf, welchen der Fluss durchläuft, viel näher an der Babunakette, als an dem westlichen Rande der Ebene liege. Endlich aber lehrte uns der Augenschein, dass das Dorf Aramanli nicht, wie Kiepert nach Griesebach angibt, auf dem nördlichen Ufer der Czerna, sondern an dem Florinabache, eine starke halbe Stunde von seiner Mündung in die erstere, also eben so viel südlich von ihr liegt. Verbindet man diese Daten mit der Behauptung der Welesaner, dass die Czerna nicht drei, sondern sechs Stunden südlich von Welesa in den Wardar münde, so berechtigen sie zu der Annahme, dass eine genauere Untersuchung des Laufes der Czerna die barocken Windungen etwas ermässigen werde, welche sie auf Kiepert’s Karte beschreibt.
Noch bedeutender aber weichen unsere Beobachtungen von Kiepert’s Ansatz der Stadt Florina ab, denn so oft wir auch den Lauf der sogenannten Suchakette, der südlichen Fortsetzung des Peristeri, mit der Richtung unseres Compasses verglichen, so zeigte er sich vollkommen parallel mit demselben streichend. Wir wussten aus Erfahrung, wie täuschend solche Vergleichungen ausfallen, besonders wenn sie, wie hier, von einem niederen Standpuncte aus angestellt werden, und wiederholten sie daher mehrmals gemeinschaftlich mit Major Zach, erhielten aber stets dasselbe Ergebniss. Streng genommen müsste hier noch die Déclination der Magnetnadel in Anschlag gebracht werden. Bei der Unsicherheit unserer Beobachtungen wollen wir dieselbe jedoch unberücksichtigt lassen, und nur so viel sagen, dass von der Ebene aus betrachtet, die Suchakette von Bitolia bis etwa zwei Stunden südlich von Florina in gerader Richtung von Nord nach Süd zu laufen scheint. Da nun Florina in der Mündung eines Querthals dieser Kette liegt, so kann sein Meridian wenigstens nicht östlich von dem von Bitolia liegen. Kiepert setzt sie aber etwa zwei geographische Meilen östlich von diesem letzteren [1], und
1. Vermuthlich nach Grisebach II, S. 107.
![]()
193
gibt auch der Sucha- oder Neretschkakette die Richtung von Nordwesten nach Südosten.
Etwa vier Stunden von Bitolia hört die wagrechte Fläche auf und zeigen sicli verschiedene Flachrücken, deren bedeutendster von den östlich von dem Dorfe Rachmanli (Aramanli) gelegenen Vorbergen des hohen, die Gegend beherrschenden Nidsché auslaufend, die Ebene quer durchschneidet und sich an den Westrand derselben anschliesst. Er dürfte schwerlich irgendwo 100 Fuss höher als der Czernaspiegel sein, und macht den Eindruck, als ob er von der Fluth zu der Zeit angeschwemmt worden sei, als die Wassermasse des See’s, welcher in der Urzeit die Ebene bedeckte, am Fusse des Nidsché sich Bahn zum Abflüsse in östlicher Richtung gebrochen hat.
Dieser Rücken theilt die Ebene in zwei Theile, deren kleinerer, südlicher nach seinem Hauptorte Florina genannt werden könnte. Der wagerechte Boden dieses letzteren mag von Osten nach Westen drei bis vier Stunden und von Norden nach Süden etwas weniger betragen. Dies Becken wird von dem Florinabache bewässert, welcher, aus einem Querthale der Sucha Planina kommend, bei Florina in die Ebene tritt, hier einen grossen Bogen gegen Süden beschreibt und dann in der Richtung von Süden nach Norden, den erwähnten Höhenrücken durchschneidend, der Czerna zufliesst [1].
Die Häuserzahl von Florina, welches wir wohl auch Flurina, aber niemals Filurina aussprechen hörten, wurde uns gewiss übertrieben auf 3000 [2] angegeben, deren Bewohner halb aus albanesischen und osmanischen Muhammedanern, halb aus christlichen Bulgaren bestünden.
Nachdem die neue Strasse den die Ebene theilenden Höhenrücken überstiegen, kreuzt sie den von Westen kommenden Ruffbach kurz vor seiner Mündung in die Florina. Wir fanden hier eine grosse Anzahl Arbeiter mit dem Baue einer steinernen Brücke beschäftigt, welcher schon ziemlich weit vorgerückt war, und kreuzten wenige Minuten später die Florina auf einer gut gebauten Holzbrücke bei dem Dorfe Sakulewo, in dessen schmuckem, neuerbautem Chane wir übernachteten, da die kaum fünfstündige Tour durch die Ebene die Pferde sehr angegriffen hatte.
Dies Dorf liegt drei Stunden nordöstlich von Florina, die alte Poststrasse von Bitolia nach Wodena führte aber noch eine Stunde weiter von Florina ab über das Dorf Rachmanli.
1. Nähere Details geben die topographischen Notizen der ersten Auflage.
2. Pouqueville III, 185, gibt der Stadt nur 700 Häuser.
![]()
194
Die Eruirung dieser Sachlage kostete uns grosse Mühe. Dass die neue Strasse nicht über Florina führe, das hatten wir schon in Bitolia erfahren, natürlich hielten wir aber auf Kiepert’s Autorität an dem Gedanken fest, dass die alte darüber geführt haben müsse, und dies brachte die grösste Verwirrung in die Angaben unserer beiden Begleiter. Zum Glücke war der eine der fähigste Kopf, dem wir auf der ganzen Beise begegneten, er merkte unsere falsche Voraussetzung, regulirte sie und rückte dann mit grosser Klarheit alle Puncte auf ihre rechte Stelle. Die Art, wie er zu Pferde sitzend, die Lage der einzelnen Puncte auf seinem eingebogenen Arme und übrigem Körper bezeichnte, brachte uns auf den Gedanken, ihn die ganze Ebene zeichnen zu lassen. Nachdem wir uns also in dem Chane eingerichtet hatten, erhielt Jusuf Konturatschi, der albanesisch, bulgarisch, türkisch und sogar etwas griechisch spricht, und auch seines netten Benehmens wiegen unseren Nachfolgern als Reisebegleiter empfohlen w erden kann, eine Hand voll Bohnen, mehrere Strohhalme und Bindfaden und ein kleines, die Strecke einer halben Stunde vorstellendes Reis in die Hand, und wurde angewiesen, mit diesen Körpern die Strecke von Bitolia bis Sakulewo mit ihren Bächen, Dörfern und Strassen auf dem Boden unserer Stube bildlich darzustellen. Dies Machwerk gelang zwar nicht auf den ersten Schlag, aber es wurde so lange frisch begonnen und verändert, bis es gegen verschiedene Prüfungslinien Stich hielt, welche wir durch dasselbe zogen.
Am folgenden Morgen durchfuhren wir in der Richtung von Norden nach Süden mit allmählig zunehmender östlicher Abbeugung die Ebene von Florina, welches, als wir es rein westlich vor uns erblickten, wohl über zwei Stunden von uns entfernt war, und erreichten in zwei Stunden Banitza, ein aus 130 bulgarischen Häusern bestehendes Dorf an dem Nordabfalle des Südrandes der Ebene. Dieser Rand wird durch einen Bergzug gebildet, welcher, sich von dem Nidschéstocke ablösend, anfangs gegen Südwesten, dann aber gegen Westen streicht und sich dabei mehr und mehr verflacht, während die den Westrand des Beckens bildende Kette auch südlich von Florina sowohl ihre frühere Höhe und den steilen scharf gezeichneten Abfall gegen die Ebene, als auch ihre Richtung von Norden nach Süden beibehält.
Von dem Querthal von Florina an zählten wir noch drei Einschnitte in dieser Kette, welche etwa eine Stunde von einander abstehen mochten. Das aus den zwrei nächsten Einschnitten kommende Wasser fällt in die Florina, gehört also zu dem Czernagebiete. Dagegen soll nach Versicherung der Banitzaner der aus dem letzten
![]()
195
Einschnitte kommende Bach in den See von Ostrowo fallen, was uns jedoch nicht glaublich ist. Mit der die Südwand dieses Einschnittes bildenden Erhebung endet für unseren Gesichtspunct die Gebirgskette, ohne sich mit einer andern zu verzweigen.
Die topographischen Notizen über die auf und an jener Kette gelegenen Dörfer ergeben das Resultat, dass dieselbe vorherrschend von Albanesen bewohnt ist, und diese hie und da ziemlich weit in die Ebene hineinragen. Man unterscheidet in dieser Ebene bei den Albanesen ihre beiden Hauptstämme, und spricht von gegischen und toskischen Dörfern, eine Unterscheidung, die wir leider in unseren Notizen vernachlässigten.
Kurz vor Banitza zweigt sich der Weg nach Larissa von der neuen Strasse ab und führt durch einen Kirili Derwent genannten und eine Stunde südwestlich von Banitza gelegenen Pass über die Südwand des Czernabeckens. Als wir dies hörten, erkundigten wir uns in Banitza sogleich nach Alterthümern, und fanden uns in unserer Erwartung in so ferne nicht getäuscht, als unsere Frage nicht verneint wurde, wenn auch Das, was wir fanden, kaum der Rede werth ist. Man wollte uns eine Steinschrift zeigen, aber alles Suchen au der Stelle, wo die Platte früher gelegen haben soll, war vergebens. Dann führte man uns zur Kirche Panagia, bei welcher wir eine Substruction aus antiken Quadern und die Reste eines heidnischen Grabsteines mit zwei weiblichen Figuren sahen. Bei der Kirche St. Nicolaus erstand Major Zach von dem Pfarrer den etwa anderthalb Fuss langen Torso einer kleinen männlichen Statue; auch brachte man uns mehrere römische Kupfermünzen. In der Nachbarschaft des Dorfes sollen noch vier Kirchen stehen, jedoch ohne irgend antike Reste, und wir erwähnen derselben nur zur Unterstützung der Behauptung der Banitzaner, dass hier früher eine grosse Stadt gestanden habe.
Die vorerwähnte Gabelung zweier durch Pässe führender Hauptstrassen am Rande der Ebene und das Vorhandensein jener Reste führen zu der Vermuthung, dass Banitza eine Station der Via Egnatia gewesen sei, und dass die neue Strasse genau in der Richtung der alten Römerstrasse laufe.
Von Banitza ging es die südliche Böschung eines zum Czernagebiete gehörenden Schluchtthaies in östlicher und nordöstlicher Richtung aufwärts zu dem Dorfe Gornischewo, wo wir in Ermanglung geeigneter Unterkunft bis Wodena abermals Nachtquartier machten, denn diese Strasse zählt von Banitza an bis Wodena nur einen schlechten Chan jenseits des See’s von Ostrowo.
![]()
196
Gornischewo liegt genau auf der Wasserscheide der Czerna und des Beckengebietes jenes See’s, in einer breiten, mit fruchtbarer Ackerkrume bedeckten Einsattlung, so dass wir deren Höbe auf einem bebauten Felde massen, sie beträgt 2919 Fuss. Dieser Sattel ist ein bekannter Räuberwechsel, weil er die einzige Verbindung des Nidscké mit der Neretsckka Planina ist, und aus diesem Vorwände gab uns der Passwächter von Banitza noch zwei von seinen Leuten mit.
Wir benutzten die gezwungene Musse in Gornischewo, um mit Jusuf den Rest des Czernabeckens zu zeichnen und die ganze Arbeit bis Bitolia zu revidiren, und glauben daher, dass dieser Theil unserer Karte sich als der genaueste bewähren werde. Wir beschlossen mit demselben unsere topographischen Arbeiten, denn der See von Ostrowo und die Gegend von Wodena waren ja bereits von Leake und Grisebach sorgfältig untersucht worden; auch fühlten wir uns so geistesstumpf und von der Monotonie dieser trockenen Beschäftigung, der wir seit unserem Eintritte auf türkisches Gebiet ohne Unterlass obgelegen, in dem Grade angewidert, dass wir mit wahrer Sehnsucht dem Augenblicke entgegen sahen, wo wir sie mit Fug und Recht abschliessen zu dürfen glaubten.
Wir verliessen Gornischewo bereits um halb fünf Uhr Morgens, um sicher das acht Stunden entfernte Wodena zu erreichen, und fuhren geraume Zeit, ehe die trübe Tagesdämmerung durch den Nebel drang, der uns umgab. Der Weg ging bergab in der Richtung gegen Osten und Nordosten, und bei dem ersten Tagesscheine erblickten wir gegen Süden einen Theil des kleinen Kesselsee’s von Petritska, an dessen südwestlichem Ufer der Weg nach Larissa vorüberführt, und bald darauf durch die Oeffnung der Schlucht, in welcher der Weg abwärts zieht, den See von Ostrowo.
Man rechnet von Gornischewo drei türkische Stunden bis zu dem Flecken von Ostrowo. Auf halbem Wege liegt ein Wachthaus, an welchem wir uns jedoch nicht auf hielten. Etwa eine halbe Stunde abwärts von demselben erreicht der Weg das nördliche Ufer des See’s, welcher bei dem gegenwärtigen hohen Wasserstande mit dem von Sarigjöl nach der Behauptung unserer Begleiter nur einen einzigen Spiegel bildet, denn beide Seen haben bekanntlich keinen oberirdischen Abfluss. Ist dies richtig, so muss derselbe bei Hochwasser von Norden nach Süden sieben Stunden lang sein. Wir können nur so viel sagen, dass wir mit dem Fernrohre im Süden kein Ufer zu entdecken im Stande waren. Seine Breite mag im Norden wenigstens anderthalb Stunden betragen.
![]()
197
Mit Ausnahme seiner Nordostecke hat der See steile, und namentlich auf der Ostseite sehr gezackte Ufer, denn hier bilden die in das Wasser vorspringenden Riffe eine Reihe schöner Buchten.
Ostrowo liegt etwa eine halbe Stunde südlich von dem Nordostwinkel des See’s und der Strasse, und gewährt vermöge seiner zwischen den See und den ihn longirenden Höhenzug geklemmten Lage einen malerischen Anblick, welcher durch eine etwa zwanzig Minuten von dem Orte entfernte, unmittelbar aus dem See aufsteigende Kuppelmoschee mit Minaret sehr gehoben wird. Es schien, als schwämme sie auf dem Wasser und stände dessen Spiegel bereits über den Fundamenten des Baues. Denn man versichert uns, dass der See seit zehn Jahren um einige Klafter gestiegen sei, was uns jedoch nicht glaublich ist, wenn, wie wir hörten, der, beide Seen verbindende Canal bei Albanköi im Sommer austrocknet. Die Strasse führt längs des steil aufsteigenden nördlichen Ufers meistens auf künstlicher Grundlage hin: diese besteht aus einer Kalkmauer, welche zugleich als Parapet gegen den See dient.
In der Nordostecke öffnet sich ein breites Thal, durch welches ein ziemlich beträchtlicher Bacli dem See zufliesst. Der Weg kreuzt dasselbe und führt, ohne Ostrowo zu berühren, ein von Süden nach Norden laufendes kleineres Thal aufwärts, zwischen welchem und dem See nur der erwähnte felsige Höhenzug liegt.
Obgleich wir den See von Ostrowo in möglichst ungünstiger Beleuchtung sahen , so möchten wir ihn dennoch für das schönste Naturbild erklären, welches wir auf der ganzen Keise sahen, denn von dem richtigen Standpuncte aus, welcher südlich zwischen jener Inselmoschee und dem Städtchen liegen dürfte, gruppirt sich hier Alles, was der Maler nur wünschen kann unter einem Augenwinkel : im Vordergründe der Seespiegel, rechts durch das an das Felsufer geklebte und mit mehreren Minarets gezierte Städtchen, links durch jene Inselmoschee begrenzt, im Mittelgründe das breite, steil aufsteigende Gerolle eines von der Höhe herabkommenden Regenbaches, mit Eichwald eingefasst, und darüber eine eigenthümliche Reihe von schneeweissen Felsen, im Hintergründe endlich die alpinen Formen des Nidschégipfels.
Wir mussten dieses Bild so zu sagen errathen, denn die tiefgehenden, schwer geladenen Regenwolken erlaubten uns nicht einmal, über jene merkwürdigen weissen Felsen klar zu werden, welche wir anfangs für Schneemassen hielten, und begannen gerade hier sich ihrer Last in feinem Regen zu entladen, welcher den Tag über mit Gewitterschauern von solcher Heftigkeit wechselte, dass wir
![]()
198
die Wände des engen Thales nicht mehr unterscheiden konnten, durch welche der Weg führt.
Wir fuhren etwa eine halbe Stunde lang jenes den See longirende Thal aufwärts, überstiegen eine dasselbe abschliessende Höhe, stiegen aber zu unserem Erstaunen abermals in ein in gleicher Richtung von Norden nach Süden laufendes Thal herunter, und gelangten in diesem nach etwa zehn Minuten an die Stelle, wo der Weg von Wodena nach Ostrowo sich von der Strasse abzweigt. Eine Viertelstunde von da öifnete sich ein Seitenthal gegen Süden, und durch dieses erblickten wir den See nochmals in einer Entfernung von etwa zwanzig Minuten. Erst von hier an wendet sich die Strasse von dem See ab gegen Osten und führt durch ein freundliches Thal in drei Viertelstunden zu dem von unserer Begleitung Derwen (Pass) von Ostrowo, von anderen Reisenden Karakaja genannten Orte, welcher aus einem Wachthause für die Besatzung, einem Chane und mehreren Hütten besteht.
Von hier fuhren wir durch ähnliche Thäler so rasch es der Weg und der fast permanente Platzregen erlaubten, an dem Sumpfsee von Techowo vorüber, erreichten in zwei Stunden das,, so weit aus den an der Strasse gelegenen Häusern ersichtlich,· sehr behäbige Dorf Weadowa, in welchem wir auf einer Holzbrücke vom linken auf das rechte Ufer des Wodenabaches übergingen, und fuhren auf einem vortrefflich chaussirten Steige die Absätze herunter, über welche sich der Bach mit seiner ganzen Wassermasse donnernd und schäumend herabstürzt, ein Schauspiel, welches wir mehr hörten als sahen, denn der Donner dieser Wasserstürze übertäubte nicht nur das Klatschen des Regens, sondern unsere eigenen Stimmen, während der Blick nur mühsam durch den Schleier drang, welchen Regen und Dunst um dieselben gezogen hatte.
Die vortreffliche Strasse führte uns von da so zeitig nach Wodena, dass wir noch einen Blick aus den Fenstern der bekannten Metropolis, welche allen Reisenden zur Herberge dient, auf die berühmte Oertlichkeit dieser Stadt werfen konnten.
Das sanft geböschte Thal, in welchem die Wodena fliesst, zeigt sich hier plötzlich in der Quere abgesclmitten, und hart an dem Rande dieses Abschnittes liegt die Stadt. Von diesem Rande sieht man in eine tief unten liegende, mit einem Baummeer bestandene Mulde hinab, und steigt man zu dieser auf steilen Treppen hinunter, so hat man rückblickend eine senkrechte, geradlinige Felsmauer von etwa 60 Fuss Höhe vor sich, deren Rand mit Häusern gekrönt ist, und über welche sich der Wodenabach in fünf Armen herunterstürzt.
![]()
190
Blickt man von oben gegen Osten, so öffnet sich zwischen den das breite Thal flankirenden Bergen die Aussicht über die Mündungsebene des Wardar, und können gute Augen bei reiner Luft die weissen Mauern der Citadelle von Salonik und die Contouren der hinter ihnen liegenden Kortatschkette unterscheiden, obwohl letztere in gerader Linie etwa 24 Stunden von Wodena entfernt sein dürfte. Dies ist der Ort, welchem alle Reisenden der Südosthalbinsel den Apfel der Schönheit zuerkennen. Auf eiskaltem Boden stehend und von feinem Sprühregen bethaut, kostete es einige Mühe, die uns anstarrende Reiserwelt mit üppigem Grün zu bekleiden und das Gesammtbild mit dem Zauber südlichen Lichtes zu vergolden, als es uns aber gelungen war, begriffen wir den feenhaften Eindruck, welchen es zur rechten Zeit und im rechten Lichte auf den Naturfre- und üben müsse. Gleichwohl gehört Wodena zu den Bildern, die sich nicht malen lassen, denn von unten betrachtet, fehlt es der geraden, die ganze Breite füllenden Felsmauer an allem Hintergründe, und um diesen zu gewinnen, müsste man so hoch steigen und so weit zurückgehen, dass aller VorGrund, ja selbst der MittelGrund verloren ginge.
XXX. Von Wodena nach Salonik.
Wir erkundigten uns in Wodena vor Allem, oh der Uebergang über den Wardar möglich sei; dies wurde von den aus Salonik kommenden Reisenden bejaht, jedoch mit dem Zusatze, dass die Passage der Bergwässer, welche der Weg zwischen dem Wardar und Wodena kreuze, schwierig sei und durch den gefallenen starken Regen unmöglich zu werden drohe. Wir eilten daher, dieser Anschwellung zuvorzukommen, und verliessen Wodena, welches von Leake und Griesebach bereits erschöpfend beschrieben ist, nach einem Rundgang zu den wenigen erhaltenen Inschriften, den einzigen Resten aus dem Alterthume, da wir nicht sicher waren, ob sie bereits copirt seien. Sie scheinen uns sämmtlich aus römischer Zeit zu datiren, und somit jede sichere Spur von der alten Gräberstadt der macedonischen Könige verwischt zu sein.
Die Strasse führt in einem gegen Süden gebauchten Bogen recht bequem den Absatz herab, auf welchem die Stadt liegt, und war auch in dem unteren Thale so vortrefflich, dass wir rasch nach dem Städtchen Wardar Jenidsché gelaugten.
![]()
200
Dort ging es sehr lebhaft zu, denn alle Welt war in den Vorbereitungen zu der jährlich hier abgehaltenen achttägigen Messe begriffen, welche nach der von Seres für die bedeutendste dieser Küstenländer gilt und auf der ganzen Halbinsel bekannt ist.
Der Ort unterscheidet sich in nichts von den türkischen Landstädtchen, die wir auf unserer Reise durchwandert, und doch gab er uns viel zu denken. Seine Existenz musste nämlich, gleich der alter Naturstädte, irgend einem Naturbedürfnisse entsprechen, und doch vermochten wir in dem Umstande, dass er halbwegs zwischen dem Wardarrinnsal und Wodena liegt, und von hier der Weg nach der noch unbekannten, aber versteckt gelegenen Landschaft Moglena führt, kaum die zur Bildung eines städtischen Centrums nothwendige Kraft zu finden, geschweige die Anziehung zu erklären, welche der Ort durch eine Messe über weite Räume ausübt. Diese Zweifel brachten uns auf die Vermuthung, dass die türkische Landstadt die Nachfolgerin der ihr nahen altmacedonischen Hauptstadt sei, und von dieser die städtische Kraft und die jährliche Messe geerbt habe, dass mithin Jenidsché nichts anderes als das verlegte Pella sei.
Mit diesen Gedanken betraten wir die kaum eine Stunde ostwärts von Jenidsché gelegene Stelle, wo das alte Pella gestanden haben soll. Die dort noch sichtbaren spärlichen und so oft beschriebenen Reste, mehr noch aber die antiken Töpferscherben, diese untrüglichsten Zeugen antiker Städte, mit welchen die jetzige Ackerfläche des alten Stadtgrundes so reichlich gesättigt ist, beweisen, dass hier eine solche gestanden habe. War dies aber der Geburtsort Alexanders des Grossen, oder fand bereits im Alterthume, etwa zur Römerzeit, eine Verlegung der Stadt auf diese Stelle statt? denn Livius’ Beschreibung [1] versetzt die königliche Burg von Pella auf eine künstliche, ummauerte Insel, welche in dem der Stadt zunächst
gelegenen Sumpfe lag, und von weitem betrachtet mit der Stadtmauer verbunden zu sein schien, in Wahrheit aber durch einen überbrückten Fluss von derselben geschieden war. Diese Beschreibung passt nicht zu der Stadt, welche auf der zwischen der, Pella genannten Quelle und der bei der oft beschriebenen einzelnen Säule lehnansteigenden Fläche gelegen hat, denn sie ist zu weit von den Sümpfen entfernt, und den etwa 20 Minuten südöstlich von der Pellaquelle bei dem Dorfe Jenikiöi gelegenen künstlichen Erdhübel, von
1. XLIV, cap. 46, situm urbis undique aspiciens. quam non sine causa delectam esse regiam advertit.
![]()
201
welchem Leake [1] spricht, konnten wir nicht aufsuchen. Audi wir mussten also die Bestimmung der macedonischen Königsburg Andern überlassen, und vorwärts eilen, um dem Wardar, über den wir am folgenden Morgen setzen wollten, so nahe als möglich zu rücken.
Wir wiesen daher auch die Kavassen an, auf der Strasse zu bleiben, als sie bereits vor Sonnenuntergang nach einem unfern des Weges gelegenen Tschiflik abbeugen wollten, um dort zu übernachten. Es schien, als ob sie ungern gehorchten, doch wagten sie keine Einrede. Wir fuhren also noch bis zu dem Chane, welcher nur eine Stunde vom Wardar entfernt liegt, und kamen mit sinkender Nacht dort an, aber der erste Blick auf dieses in einem sumpfigen Grunde gelegene, verwahrloste Gebäude belehrte uns, dass wir in die Herberge gerathen, welche, wie wir in Wodena gehört hatten, vor etwa zwei Monaten ausgemordet worden war. Auf unsere Frage erzählten uns die gegenwärtigen Inhaber des Chanes, zwei confiscirte Gesichter, wie die Räuber durch ein in die Mauer des Hauses gegrabenes Loch eingedrungen wären und hier den alten Chandschi, dort den einen und in jenem Winkel den andern seiner Diener niedergemacht und verstümmelt und dann die drei türkischen Pferdetreiber, die im Stalle schliefen, erschlagen hätten. Am andern Morgen habe man die sechs Leichen, von den Thätern aber natürlich keine Spur gefunden. Ueber die Motive dieser Gräuelthat herrscht völlige Ungewissheit, nur so viel scheint sicher, dass sie nicht aus Habsucht verübt worden, denn der Chandschi war arm und die Pferdetreiber waren unberaubt.
Nun war freilich jener Act viel zu neu und wir viel zu zahlreich und wohlbewaffnet, um irgend einen Versuch gegen uns zu befürchten, gleichwohl kam es uns schwer an, in einer von dem vergossenen Blute fast noch rauchenden Mördergrube zu essen und zu schlafen. Doch wir waren hungrig und müde, wir assen also und schliefen trotz aller Gräuel, die uns umgaben; wir gestehen indessen, dass unser Schlaf weit leiser als gewöhnlich war und durch das kleinste Geräusch gestört wurde. Bei einer dieser Gelegenheiten sahen wir, dass ein Kavasse bei dem Kohlenbecken sass und rauchte, und hörten am Morgen, dass er mit seinem Kameraden abwechselnd gewacht habe.
Wir brachen mit der ersten Dämmerung auf, fuhren durch dichten Nebel, der sich allmählich zum dichten Rieselregen verdichtete, auf schwarzem, sumpfigem und mit Wasseradern durchzogenem Grunde zu dem War dar,
1. Travels in Northern Grece ΙΙI, p. 201.
![]()
202
und erreichten nach einer guten Stande die Stelle, wo eine Reihe von Büffelwagen stand. Der Anblick der davor gespannten Thiere belehrte uns, dass der Büffel als letzter Zeuge aus einer früheren Schöpfungsperiode in unsere europäische Welt hereinragt, denn diese Urthiere waren würdige Weidgenossen der Mamuthe und anderer Paläotheren. Unter alb unseren Hausthieren ist der Büffel überhaupt bei weitem das ungeschlachteste und zwar nicht blos im Hinblick auf Structur und Behaben, sondern auch auf seine jötünische Gemüthsart. Hier aber hatten die Wardarsümpfe Ungeheuer gross gezogen, welche sich zu dem gemeinen Büffel wie der friesische Frachthengst zum Kosakenpferdchen verhielten. Wir suchten die zwei grössten Paare aus, hinter deren Wagen die unserigen gebunden wurden, nachdem das Gepäcke überladen worden. Der Boden dieser Wagen ist nahe an fünf Fuss über der Erde gestellt, und sie erhalten hierdurch trotz der Plumpheit der Räder und des Gestelles ein luftiges Ansehen. Im Vergleiche zu dieser Höhe erschien uns jedoch die Spurweite zu schmal, und wir gestehen, dass wir dieselben, nachdem Alles vorbereitet, mit einer Beklommenheit bestiegen, welche der Furcht sehr ähnlich war. Der Fuhrmann, ein muhammedanischer Bulgar, stellte sich auf das hintere, brettartig geformte Ende der Deichsel, und rief mit weichem, fast zärtlichem Tone: „Ju ! Väterchen, Ju! Onkelchen“, indem er beide Thiere mit einem dünnen Haselstäbchen auf die Schultern tupfte. Diese setzten sich sofort in Bewegung, und ihre Folgsamkeit würde uns billig in Erstaunen gesetzt haben, wenn wir nicht eine scharfgespitzte Eisenzwecke am Ende des Zauberstäbchens und einen braun gefärbten rauhen Fleck auf den unbehaarten schwarzen Schultern der Thiere bemerkt hätten. Wir würden gerne von dem Fuhrmanne Auskunft über die Art und Weise verlangt haben, wie diese Colosse eingefahren werden, aber wir hielten es nicht für rathsam, seine Aufmerksamkeit von Väterchen und Onkelchen abzuwenden, welche er ohne Unterlass durch freundlich ermunternde Schmeichelreden zu unterhalten suchte, während er von dem Stäbchen nur, wenn es Noth that, Gebrauch machte. So ging es langsam schleichend durch Dick und Dünn, wir setzten, die Lachen ungerechnet, über fünf oder sechs Flussarme, wobei den Thieren das Wasser mehrmals bis zum Rückgrade reichte, und der Wagen mehr als einmal in beklemmende Situationen gerieth; wir bestanden jedoch die ganze Fahrt ohne Unfall, denn dass der Bagagewagen von einer Strömung umgerissen und in dieser Lage herausgeschleift wurde, war ohne Consequenz. Nach anderthalb Stunden endlich hielt der Zug an einem mit Bäumen bestandenen Platze vor einem Chane.
![]()
203
Die Wagen wurden losgebunden und beladen, die Pferde davor gespannt, und wir glaubten nun den War dar hinter uns zu haben, als wir durch den Nebel den Anfang einer Brücke erblickten, welche der Major abschritt, oder, wenn wir nicht irren, 740 Schritt lang fand [1]; doch der Strom, der unter ihr hinfloss, musste kurz vor unserem Uebergange noch breiter gewesen sein, denn am Ostende der Brücke hatten wir ein gutes Stück durch den Flussschlamm zu waten, um zu dem Chane zu gelangen, wo wir frühstücken wollten, und doch war dies nur ein Theil der Wassermassen, welche weiter oberhalb in ungeteiltem Bette fliessen !
Als wir in jenem Chane ankamen, zeigte die Uhr bereits halb Eins. Die Entfernung nach Salonik wurde uns auf fünf türkische Stunden angegeben, welche hier zu Lande der Fuchs gemessen hat, mit dem Zusätze, dass der Thorschluss jener Festung strict mit der eintretenden Dämmerung statthabe. Herr Gottschild ritt daher sogleich dorthin voraus, um uns die Thore offen zu erhalten. Doch war dies unnöthige Vorsicht, denn die Pferde trabten so munter durch den Plan, dass wir genau mit Untergang der Sonne ankamen, welche uns zum Abschied ihre lang entzogene Gunst wieder schenkte. Diese letzte Fahrt rechnen wir zu den angenehmsten der ganzen Reise; ebener, trockener Weg, sonniges Wetter, die interessante Landschaft, in welcher wir rechts auf die herrlichen Contouren des Olymp und vor uns auf das minaretreiche, zu seiner Citadelle stattlich aufsteigende und stets näher rückende Salonik blickten; der Gedanke, am Ziele eines Unternehmens zu sein, welches uns so lange Jahre vorgeschwebt, Alles vereinte sich, um unsere Stimmung zu heben, und dennoch fand sich ein Dämpfer für dieselbe, denn plötzlich verfielen wir auf die Frage, was lässt sich ausser Dorfnamen, Häuserzahlen und Flussrichtungen über eine Reise durch prosaische Länder sagen, wenn sie so platt und zahm verlaufen ist wie die unsere? und diese Frage möge uns bei dem Leser entschuldigen, der uns bis hieher treu geblieben, wenn er sich durch die fast ununterbrochenen Schilderungen der todten Natur gelangweilt fühlte; wir gaben so viel Staffage ' zu denselben, als wir irgend auftreiben konnten, aber sie zur Unterhaltung des Lesers auszuschmücken oder mit Episoden eigener Erfindung zu vermehren, dafür war unsere Aufgabe zu ernst.
1. Nach Grisebach II, 77, ist die Brücke noch länger, denn er giebt ihr gegen 2000 Fuss und vergleicht sie mit der Rheinbrücke hei Mainz. Er setzt die Breite des Rheins nach Hoffmann, Deutschland Thl. I, S. 296, am oberen Ende der Stadt Mainz auf 1800, am unteren 2500 Fuss.
![]()
204
Wir nehmen vom Leser vor den Thoren von Salonik Abschied, denn diese Stadt ist schon so oft von Meisterhand geschildert worden [1], dass wir keine Ilias post Homerum liefern wollen, und es daher vorziehen, unseren Bericht mit einer kurzen Uebersicht der Hauptergebnisse unserer Heise zu beschliessen.
Der nördlichste Punct des ethnographischen Albanien fällt zwischen den 43. und 44. Grad nördlicher Breite, da, wo die bulgarische Morawa in die serbische Grenze eintritt.
Der Albanese ist hier der südliche Grenznachbar des Serben, und bewohnt den Kern des alten Ost-Dardaniens, d. h. des von der bulgarischen Morawa umgrenzten Halbkreises.
Gegen Osten hat er diesen Fluss bei der Mündung des Massuritzabaches überschritten und bewohnt das Mündungsgebiet dieses Baches und das angrenzende Ostufer der Morawa.
Gegen Süden hat er das Défilé dieses Flusses zwischen Gilan und W ran ja und das Morawitzathal inne, und zieht sich über den Karadag und das Lepenatzdéfilé eine vermutlich ununterbrochene Verbindungslinie albanesischer Dörfer zwischen dem albanesischen Dardanien und dem Mutterlande.
Gegen Westen besteht eine ähnliche Verbindungslinie, welche durch die Gebiete der zwei Drenitzabäche läuft.
Die zwischen diesen Verbindungslinien liegenden Flächen, nämlich das Quellbecken der bulgarischen Morawa, das Amselfeld und die Metoja, sind Mischbezirke, und werden von Albanesen und Serben oder Bulgaren gemeinsam bewohnt.
Mischbezirke sind auch das Quellbecken des Wardar und die Quellgebiete der Treska und Czerna.
Der Kern des Dreiecks zwischen der Treskainündung und dem Wardar wird nur von Albanesen bewohnt, welche im Bachgebiete Swesitza bis an das Westufer des Wardar reichen.
Die Albanesen bewohnen, mit Bulgaren vermischt, den ganzen Westrand des Ringbeckens der Czerna.
Der Weg von Belgrad nach Salonik ist fahrbar. Eine längs den Rinnsalen der vereinigten und der bulgarischen Morawa und dem Wardar laufende Eisenbahn wäre leicht ausführbar, denn sie hätte keine einzige Höhe zu passiren und nur die Schwierigkeiten einiger Flussdéfilé's zu überwinden.
1. In der Vorrede zu Tafel’s Via Egnatia finden sich sämmtliche neuere Schilderungen in extenso zusammen gestellt.
![]()
205
Diese Bahn würde die Hauptarterie des europäisch-asiatischen und afrikanischen Verkehrs bilden.
Wenn wir aber von dem Leser somit Urlaub nehmen, so geschieht es in der Hoffnung, mit ihm auf demselben Felde dereinst wieder zusammenzutreffen, denn so viel Licht auch die Arbeiten Boué’s, Viquesnel’s und Grisebach’s über die europäische Türkei verbreitet haben, so manches Neue auch diese Blätter bringen mögen, so bleibt noch viel zu thun, bevor die Epoche geographischer Entdeckungsreisen in diesen Ländern für geschlossen erklärt werden kann. Vor Allem aber dürfte es an der Zeit sein, den poch unbekannten südlichen Theil jener Kinne, durch welche künftig die Hauptarterie Europas laufen wird, kennen zu lernen [1], denn unseres Wissens hat bis jetzt noch kein Beisender den Wardar befahren oder dessen Rinnsal überhaupt untersucht, und wie wenig Vertrauen das von unseren ersten Geographen aus zerstreuten, beiläufigen Angaben hierüber zusammengestellte Bild verdiene, darüber liefern diese Blätter mehr als einen Beleg.
1. S. hierüber des Verf. Reise in den Gebieten des Drin und Wardar. Wien, Carl Gerold’s Sohn 1867.